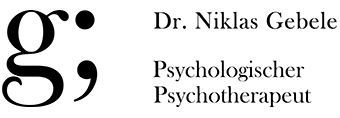Vortrag am 22. September 2019 im Odeon, Göppingen
Für mich war „Einer flog über das Kuckucksnest“ aus dem Jahr 1975 schon historisch, als ich ihn als Jugendlicher zum ersten Mal gesehen habe. Als ich sechzehn war, wurde in den USA die erste Staffel der Serie ausgestrahlt, die für Viele den Beginn des Goldenen Zeitalters hochqualitativer, horizontal erzählter, charakterzentrierter TV-Serien markierte und deren berühmt gewordene erste Szene in der Praxis einer modernen, freundlichen und hochkompetenten Psychotherapeutin spielt: Die Sopranos (1999-2007).

Dr. Jennifer Melfi zählt zu den guten fiktionalen Psychotherapeut*innen (auf die Unterscheidung der Berufsgruppen Psychiater*innen und Psychotherapeut*innen verzichte ich in diesem Vortrag, da sie in den meisten fiktionalen Darstellung nicht, oder nicht korrekt getroffen wird) des 21. Jahrhunderts, die ihren Patient*innen nach Kräften helfen. Andere sind Sean Maguire aus Good Will Hunting (1997), Paul Weston aus In Treatment (2007-2010) – einer Serie, die fast ausschließlich in Pauls Behandlungszimmer spielt –, die Therapeuten aus aktuellen Netflix-Produktionen, wie To The Bone, Atypical und Lucifer sowie im deutschen Sprachraum Bloch (Dieter Pfaff, 2002-2013), die Psychologin Dr. Jung aus dem Kieler Tatort, oder der von Christian Ulmen verkörperte Dr. Psycho (2007-2008). Teilweise sind diese Psychotherapeut*innen schrullig, neurotisch, ein wenig narzisstisch und mit den ethischen Grenzen des Berufsstandes nehmen sie es nicht immer so genau – dennoch sind sie nicht zu vergleichen mit der kalten, autoritären, ja grausamen Oberschwester Ratched aus Einer Flog über das Kuckucksnest.
Schwester Ratched steht damit in der Tradition der Psycho-Protagonisten ihrer Zeit. Neben Einer Flog über das Kuckucksnest steht Alfred Hitchcocks Meisterwerk Spellbound mit Ingrid Bergmann und Gregory Peck für böse Psychiater mit gruseligen Fähigkeiten der Manipulation und Beeinflussung. Ganz zu schweigen von unzähligen Horror-B-Movies in denen durchgeknallte Psychiater und schaurige psychiatrische Anstalten zu sehen sind.
Noch 1991 erblickt einer der bekanntesten und schrecklichsten Kollegen meiner Zunft das Licht der Filmleinwand: Der hochintelligente Kannibale und Meister der Manipulation Hannibal Lecter (Das Schweigen der Lämmer).
Im selben Jahr wird Sarah Connor in Terminator II in einer gefängnisartigen Psychiatrie mit Gitterstäben und pervers-sadistischen Wärtern eingesperrt – und das obwohl sie nicht einmal krank ist: Der Terminator, Zeitreisen und die nahende Apokalypse sind ja real.
Überhaupt ist der Topos der/s zu Unrecht in der Psychiatrie zwangsuntergebrachten Gesunden, welche/r lediglich an den unhinterfragten, aber in ihrer Rigidität und Unmenschlichkeit letztlich eigentlich verrückten Gesellschaft, oder der Psychiatrie selbst, kaputt geht, beliebt. In Stieg Larssons Millennium-Trilogie wird die unliebsame Lisbeth Salander pathologisiert und zeitweise weggesperrt und auch McMurphy, in Einer flog über das Kuckucksnest, ist zwar ein Gauner – wirklich krank macht ihn jedoch erst die Psychiatrie.
Es gibt wohl eine Wechselwirkung zwischen Fiktion und Realität. Wir wissen aus der Forschung, dass fiktionale Stoffe die Wahrnehmung der Realität beeinflussen können. So fand eine österreichische Studie (Till et al., 2006) heraus, dass in Österreich lebende Personen, die viel fernsehen eher glauben, dass es dort noch die Todesstrafe gebe (die tatsächlich 1968 abgeschafft wurde), also quasi mit dem durch das Fernsehen gezeigten US-Justizsystem besser vertraut sind, als mit den Gesetzen ihres eigenen Heimatlandes.
Gleichzeitig können wir wohl mit C.G. Jung, der 1950 schrieb, dass Goethes Faust nicht nur die innerpsychischen Konflikte seines Verfassers widerspiegle, sondern die Bewusstseinslage einer ganzen Generation, davon ausgehen, dass fiktionale Stoffe v.a. dann zu Popularität gelangen, wenn sie Themen und Gefühle der sie rezipierenden Gesellschaft in eine anschauliche Form gießen.
Der Psychoanalytiker und Medienpsychologe Dirk Blothner (1999, S. 220) stellt fest, dass im Film „noch unausgeformte und revoltierende Strömungen in Bilder gefasst werden. Daher lässt sich an den wirksamsten Filmen oft auch ablesen, auf welche neue Ordnung die Gesellschaft zusteuert“.
Vor diesem Hintergrund passt, wie wir schon gehört haben, Einer flog über das Kuckucksnest perfekt in seine Zeit. Zwei Jahre zuvor, 1973, war die spektakuläre und schockierende Studie des Psychologen David Rosenhan mit dem Titel „being sane in insane places“ erschienen. In diesem klassisch gewordenen Experiment wurden acht gesunde Menschen, überwiegend Studierende, in verschiedenen psychiatrischen Kliniken vorstellig und berichteten beim Erstgespräch, Stimmen zu hören. Alle acht Pseudopatienten wurden stationär aufgenommen – soweit kein Problem. Allerdings wurden sie durchschnittlich neunzehn Tage lang „behandelt“, obwohl sie sich vom Zeitpunkt der Aufnahme an normal verhielten und nie mehr von akustischen Halluzinationen berichteten – McMurphy lässt grüßen!
Natürlich lässt sich die Rosenhan-Studie in vielfacher Hinsicht kritisieren: Mutmaßlich wohlmeinende Behandler, wurden über ein ernsthaftes psychiatrisches Symptom (akustische Halluzinationen) belogen und somit in eine Falle gelockt. Zudem wurden Behandlungskapazitäten gebunden, die eigentlich tatsächlich kranken und leidenden Patient*innen vorbehalten sein sollten. Gerade aus heutiger Sicht, wo dringend behandlungsbedürftige und behandlungswillige Menschen zum Teil Monate lang auf eine Therapie warten müssen, weil deutlich zu wenig stationäre und ambulante Behandlungsplätze zur Verfügung stehen, ist dies fragwürdig.
Tatsächlich ist die institutionalisierte Macht der Psychiatrie heute geringer, als früher. Gesetze und berufsethische Standards sollen die Menschen vor Übergriffen durch die Psychiatrie schützen – und tun dies überwiegend auch effektiv. Das Selbstbild ist – hier schneller, dort langsamer – dabei, sich vom Halbgott in weiß zum Mental-Health-Experten auf Augenhöhe zu wandeln. Auf informeller Ebenen jedoch, ist die Macht von Psychiatrie und Psychotherapie ungebrochen. Wir verfügen über die Macht der Definitionshoheit! Oft geht es um nichts weniger, als die Entscheidung, was bzw. wer normal ist, also einen legitimen Platz in der Gesellschaft zugestanden bekommt und wer bzw. was außerhalb steht. Wer heute zur/m Psychiater*in kommt, tut dies vielleicht seltener mit der Angst, „in der Psychiatrie zu landen“, wohl aber mit der Angst davor, als zu schwach, zu sensibel, zu empfindlich oder auch „zu dumm“ etikettiert zu werden, um in unserer Gesellschaft, auf dem hart umkämpften Markt der Performance als Selbstdarsteller, bestehen zu können.
Die Psychiatrie war immer und ist weiterhin in der Gefahr, sich zur Erfüllungsgehilfin gesellschaftlicher Abwehr- und Ausstoßungsprozesse zu machen. Es ist bequemer, wenn ein Attentäter, Terrorist oder Massenmörder für psychisch krank befunden wird, weil Krankheit etwas ist, wofür die umgebende Gesellschaft scheinbar nicht verantwortlich gemacht werden kann – ein Trugschluss, sicher, aber ein hartnäckiger. Genauso wie es uns allen scheinbar angenehmer wäre, das Problem Donald Trump auf eine narzisstische Persönlichkeitsstörung zu reduzieren, als der Tatsache ins Auge zu sehen, dass fast die Hälfte der Amerikaner einen rassistischen, chauvinistischen Lügner zum „Führer der freien Welt“ gewählt hat. Die Tatsache übrigens, dass sich an dieser Ferndiagnostik auch Psychiater*innen beteiligt haben, ist – unabhängig von der persönlichen und politischen Bewertung Donald Trumps – ein Kunstfehler. Psychiatrie ist eine Heilkunst und darf niemals – als Deutscher will ich hinzufügen: Niemals mehr! – zur Waffe in der politischen Auseinandersetzung werden.
Ein vergleichbarer Abwehrmechanismus erklärt aus psychologischer Sicht auch die aktuell deutlich werdende Tendenz zur Verharmlosung und Relativierung von Rechtsterrorismus ausgerechnet in Deutschland.
Große Teile der deutschen Bevölkerung empfinden, aus gutem historischem Grund, bewusst oder unbewusst, eine Verantwortung dafür, dass sich Nationalsozialismus und Holocaust niemals wiederholen dürfen. Sie fühlen sich als Staat und Gesellschaft daran gemessen und bewertet. Diese Verantwortung wiegt schwer. Man kann sie bewusst wahr- und annehmen und sich als Individuum und Teil der Gesellschaft dem Antifaschismus, Antirassismus und einer offenen Gesellschaft verpflichten. Jedoch geht mit großer Verantwortung auch eine große Versuchung einher, diese zu vermeiden, sich vor ihr zu drücken. Eine bewusste Vermeidung ist die Forderung nach Schlussstrichen. Eine unbewusste Art der Vermeidung, des Wegduckens, kann die Verleugnung des Problems, für welches man bei dessen Anerkennung Verantwortung übernehmen müsste, sein. Die Ängste, Aggressionen, Xenophobie, die man vielleicht trotz allem in sich und um sich herum spürt, lassen sich leichter projizieren als sich damit zu konfrontieren und auseinanderzusetzen. Als Projektionsfläche eignen sich die, mit denen man augenscheinlich nichts zu tun hat, für die man scheinbar nicht in Mitverantwortung genommen werden kann. Linksradikale und Islamisten zum Beispiel, mit denen ich als Durchschnittsdeutscher kaum assoziiert werde. Oder eben vermeintlich psychisch Kranke.
Michel Foucault hat diesen Abwehrmechanismus in Wahnsinn und Gesellschaft (1961) beschrieben: Bis in die Renaissance waren die sogenannten Wahnsinnigen oder Irren als „normaler“ Bestandteil in die Gesellschaft integriert. Im besten Fall als Orakel, Hellseher oder spirituelles Medium, im schlechteren Fall als Dorftrottel, Hofnarr oder gruselige Sensation. Mit der Aufklärung wurde dann das Postulat des Menschen als vernünftiges Wesen zum Mainstream, welches von Beginn an den Geburtsfehler der Verdrängung aller irrationalen, triebhaften, emotionsgesteuerten beinhaltete. Der „Wahnsinn“ als intensivste Manifestation dieser menschlichen Anteile, passt als allgemein menschliches Phänomen nicht in dieses Narrativ. Nach Christian Morgenstern: „Und er kommt zu dem Ergebnis: Nur ein Traum war das Erlebnis. Weil, so schließt er messerscharf, nicht sein kann, was nicht sein darf.“ So entstand ein Motiv für die Auslagerung des Wahnsinns und die Tilgung der „Verrückten“ aus dem alltäglichen Leben. Die ersten Anstalten entstanden, zunächst allerdings mit dem Ziel, die Menschen, die durch ihre Krankheit zu sehr von der Norm abwichen, wegzusperren. Mit Emile Durkheim könnte man sagen: Es muss immer Menschen geben, die als „verrückt“ gelabelt werden, damit die Mehrheit sich als „normal“ empfinden darf.
Der einseitige Rationalismus der Aufklärung wurde bereits von Schopenhauer und Nietzsche kritisiert, auf die sich nicht nur Foucault bezieht, sondern auch Sigmund Freud. Mit ihm vollzog die Beschäftigung mit dem Psychopathologischen einen Paradigmenwechsel. Nicht, dass es nicht schon zuvor Ärzte gegeben hätte, die psychisch Kranke nicht nur wegsperren, sondern ihr Leiden durch – zugegebenermaßen aus heutiger Sicht oft recht krude – medizinische Behandlung lindern wollten. Doch erst Freud hob die soziologisch konstruierte Trennung zwischen Verrücktheit und Normalität auf, indem er der Menschheit die sog. dritte große Kränkung zufügte: Kopernikus hatte die Erde und damit den Menschen vom Mittelpunkt des Universums auf den Platz eines seinerseits um die Sonne kreisenden Planeten unter vielen verwiesen. Charles Darwin hatte den Menschen von der Krone der Schöpfung zu einem Tier unter vielen degradiert. Sigmund Freud schließlich konfrontierte den Menschen damit, dass er noch nicht einmal „Herr im eigenen Haus“ sei, sich also des Großteils seiner Handlungsmotive kaum bewusst. Psychopathologie wird dadurch zu einer Normvariante, zu lediglich sehr stark oder sehr schwach ausgeprägten, aber universellen, gleichsam archetypischen Erlebens- und Verhaltensweise.
In dieser Tradition stehen wir als heutige Psychiater*innen und Psychotherapeut*innen. Jedem psychisch kranken Menschen zuvorderst als Mensch und erst dann als psychisch Krankem zu begegnen. Und auch – z.B. an einem Abend wie heute – gegen die Stigmatisierung psychischer Krankheit und damit die Exklusion des Abweichenden aus der gesellschaftlichen Selbstdefinition aufzustehen und anzureden.
McMurphy ist archetypisch gesehen eine Trickster-Figur. Sein Verhalten wirkt im Kontext, in dem er agiert, irrational oder sogar verrückt. Doch seine Verrücktheit ist – das wird in Einer flog über das Kuckucksnest deutlich – nicht objektiv, sondern durch den Kontext selbst zugeschrieben. Damit entlarvt er die Irrationalität und Verrücktheit des Systems selbst, fordert es heraus, zwingt es zur Selbstreflektion – und verliert nur scheinbar. Denn auch wenn der Trickster selbst noch vom System bestraft wird, hat er doch dessen Grenzen aufgezeigt und es damit hinterfragbar gemacht. McMurphys finden sich heutzutage immernoch in großer Zahl – nach einer Schwester Ratched müsste man in einer modernen Psychiatrie – und darauf können wir, denke ich, bei aller gebotenen Selbstkritik, doch stolz sein – schon länger suchen.
Den Audiomitschnitt des Vortrags zum Nachhören gibt es hier.
Literatur
Blothner, Dirk (1999): Erlebniswelt Kino. Über die unbewußte Wirkung des Films. Bergisch-Gladbach: Bastei Lübbe.
Foucault, M. (1961). Histoire de la folie à l’âge classique: Folie et déraison. Plon, Paris. Deutsch: Wahnsinn und Gesellschaft. Eine Geschichte des Wahns im Zeitalter der Vernunft. Suhrkamp, Frankfurt am Main.
Jung, C.G. (1950). Gestaltungen des Unbewussten. Zürich: Rascher