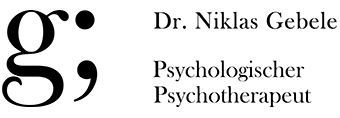Es war irgendwie klar, dass es eine zweite Staffel von 13 Reasons Why (Tote Mädchen lügen nicht) geben würde, angesichts des Erfolgs der ersten Staffel und der Ungerührtheit Netflix´ gegenüber der berechtigten Kritik. Alles, was an Staffel 1 gut war, wird in Staffel 2 erfolgreich fortgesetzt: Die (relative) Authentizität, das Gespür für die Wahrnehmungen, Themen und Entwicklungsprozesse von Jugendlichen, die ungewohnt mutige Darstellung und Reflektion schwieriger Themen. Zudem hat sich Netfilx bemüht, durch Warnhinweise und Statements einiger Darsteller nachträglich auf die Kritik angesichts des hohen Risikos von Werther-Effekten zu reagieren – was zwar grundsätzlich löblich, jedoch in dieser Hinsicht völlig unzureichend ist, da es sich um rationale Information handelt, welche der in hohem Maße zu emotionaler Identifikation einladenden Darstellung der Hannah aus Staffel 1 im Zweifel wenig entgegenzusetzen hat.
Jedoch scheinen die Serienmacher*innen tatsächlich aus den Fehlern von Staffel 1 gelernt zu haben. Hannahs Suizid wird in Staffel 2 wesentlich kritischer und differenzierter betrachtet. Sie selbst wird nicht mehr posthum zur idealisierten Hauptidentifikationsfigur stilisiert, ihre Ratlosigkeit, Unzulänglichkeit, Überforderung und auch ihr jugendlicher Egozentrismus, werden in den durch Clay imaginierten Dialogen deutlicher. Es ist spürbarer, dass Hannah nicht mehr aktiv am Geschehen teilnimmt, sondern nur ein Bild für Clays innere Zerrissenheit ist. Die zweite Staffel wird nicht mehr aus ihrer, sondern aus mehreren Perspektiven, allesamt lebender Personen, erzählt. Schließlich wird auch Hannahs eigene Ambivalenz durch eine Liste mit elf Gründen gegen den Suizid zumindest angedeutet – wenngleich das Problem, dass Suizide selten so rational abgewogene Handlungen sind, wie es bei Hannah den Anschein hat, hierdurch weiter bestehen bleibt.
Ein sehr wichtiger Unterschied zu Staffel 1 besteht außerdem darin, dass Auswege aus vielen schwierigen, und manchmal zunächst ausweglos erscheinenden, Situationen aufgezeigt werden: Justins Drogenabhängigkeit, Jessicas sexuelles Trauma, Skyes psychische Erkrankung, Alex´ Suizidalität, selbst Tylers Rachephantasien. Die Serie macht an diesen Beispielen deutlich, dass es immer Möglichkeiten gibt, auch in schwierigsten Lebenssituationen Hilfe zu bekommen und Verbesserungen zu erreichen. Gleichzeitig schaffen es die Autor*innen, dabei nicht in Beschönigung oder Verharmlosung zu verfallen: Der Weg ist steinig, von Rückschlägen und Verzweiflung begleitet und, ja, er kann auch scheitern. Aber alleine die Darstellung unterschiedlichster Möglichkeiten, von professioneller psychiatrischer Behandlung, Selbsthilfegruppen, Antiaggressionstraining, bis zum Beistand durch Freund*innen und Eltern (bis auf Justin und Monty haben die Kids ja recht bemühte und funktionale Eltern) ermöglicht gerade jugendlichen Zuschauer*innen eine wesentlich differenziertere und auch realitätsnähere Sicht auf den Umgang mit persönlichen, sozialen und psychischen Problemen. Während die erste Staffel also hinsichtlich Suizidprävention so ziemlich alles falsch gemacht hat, wird in der zweiten Staffel von Lösungsmöglichkeiten und konstruktiven Alternativen zum Suizid berichtet, was wiederum Zuschauer*innen, die selbst von suizidalen Gedanken betroffen sind, Hoffnung machen und dazu anregen, sich Hilfe zu suchen – und zwar durch die emotionale Identifikation mit den handelnden jugendlichen Charakteren, deren Lebens- und Gedankenwelt vertraut scheint, was wirksamer ist, als die bloße Information darüber, dass es Notfallhotlines gibt und wie man sie erreicht (welche natürlich dennoch notwendig ist). Diesen quasi umgekehrten Werther-Effekt bezeichnet man nach Mozart als Papageno-Effekt.
Insofern ist Clays Reflektion in der letzten Folge, dass durch Liebe Licht in diese oft als dunkel empfundene Welt gebracht werden kann, so wahr wie an dieser Stelle wichtig. Liebe im weitesten Sinne: Aufmerksamkeit, Respekt, das Bemühen darum die Perspektive der/s anderen einzunehmen und zu verstehen, vorgefasste Meinungen und Urteile zu überprüfen und die eigenen Anteile sowie die gesellschaftlichen Einflüsse auf das zwischenmenschlichen Geschehen zu reflektieren. Gesprächsbereit zu bleiben, sich selbst und anderen zweite und dritte Chancen zu geben. Natürlich geht Clay selbst dabei oft zu weit: Einem schwer Bewaffneten sollte man sich niemals so in den Weg stellen, wie er es tut. Diese letzte Szene sollten wir eher als Metapher dafür sehen, das Gegenüber nicht aufzugeben, im konkreten Fall aber das Verhandeln den Profis überlassen.
Es ist, wie bereits erwähnt, richtig und wichtig, dass die Serie in dieser Staffel professionelle psychiatrische und psychotherapeutische Behandlung als hilfreiche Option beschreibt. Deutlich wird das an Skye, die sich in eine psychiatrische Klinik zur Behandlung begibt. Es wird eine bipolar affektive Störung (ICD-10: F31) diagnostiziert, welche durch einen Wechsel zwischen depressiven und manischen Phasen gekennzeichnet ist. Hinweise auf depressive Phasen sind Skyes Selbstverletzung und der Eindruck, dass ihr suizidale Gedanken per se nicht ganz fremd sind. Manisches, also in pathologischer Weise antriebsgesteigertes, enthemmtes und kontaktfreudiges Verhalten, wird in der Szene, in welcher sie bei Clays Eltern eingeladen ist, angedeutet. Meinem Eindruck nach könnte man auch eine emotional instabile Persönlickeitsstörung vom Borderline-Typ (ICD-10: F60.31) diagnostizieren. Auch diese würde Skyes Selbstverletzung und Stimmungsschwankungen erklären, zudem ihre Unsicherheit in der Beziehung zu Clay, die impulsive Eifersucht auf Hannah und auch ihre Aussage, dass sie „all diese Gefühle“ in sich habe und diese schwer kontrollieren könne. Letztlich müssten wir noch mehr über Skye wissen, um die Frage in ihrem speziellen Fall beantworten zu können.
Auch Jessica begibt sich, wenn auch zunächst widerwillig, in professionelle Hilfe: Eine Gesprächsgruppe für Opfer sexueller Gewalt. Sie erlebt hier die heilsame Wirkung von Gruppentherapie, die bereits in den 1970er Jahren von dem amerikanischen Psychotherapeuten Irvin D. Yalom beschrieben wurde. Durch den Austausch mit Menschen, die ähnliches erlebt haben, macht sie die in diesem Moment intensiv emotional spürbare Erfahrung, nicht alleine zu sein, was mehr ist, als das bloße rationale Wissen darum, dass es natürlich andere Opfer sexueller Gewalt gibt. Darüber hinaus erlebt Jessica durch andere Gruppenmitglieder, die in ihrem therapeutischen Prozess bereits weiter fortgeschritten sind, dass es Hoffnung auf Linderung und auf ein Leben mit weniger starken Beeinträchtigungen gibt, als sie es aktuell führt und sieht ganz konkrete Modelle, wie die nächsten Schritte aussehen könnten. Schließlich gelingt es Jessica, detailliert über ihr Trauma zu sprechen. In der Serie geschieht das, wohl auch aus dramaturgischen Gründen, vor Gericht. Das muss aber nicht unbedingt so sein. Die Entscheidung, ob ein sexuell traumatisierter Mensch Anzeige erstattet und den (in der Realität im Ergebnis leider oft ebenso wie in der Serie enttäuschenden) juristischen Weg beschreitet, ist hochindividuell und niemandes Entscheidung, als die des Betroffenen selbst. So findet auch Jessica erst durch den Gruppenprozess – in diesem Fall vor allem den Entwicklungsprozess in der Gruppe ihrer Freunde, welche es endlich schaffen, sich vorbehaltlos hinter sie zu stellen, statt sie in die eine oder andere Richtung drängen zu wollen – zu dem Mut und der Kraft, für sich die Entscheidung zu treffen, Bryce anzuzeigen und auszusagen. Hierdurch erlebt sie die befreiende Wirkung des vollständigen Sich-Öffnens in einer vertrauten sozialen Umgebung und fühlt sich dadurch befreit. Diesen Effekt bezeichnet die Psychoanalyse als Katharsis (Reinigung): Dadurch, dass sie ihr Schweigen bricht, gewinnt sie Kontrolle über die Auswirkungen ihres Traumas im Hier und Jetzt zurück, fühlt sich dadurch freier und handlungsfähiger, wo sie zuvor durch Flashbacks und die Vermeidung bestimmter Situationen (z.B. körperlicher Nähe oder sich selbst nackt zu betrachten) – Kernsymptome einer posttraumatischen Belastungsstörung (ICD-10: F43.1) – stark eingeschränkt war. Deshalb ist es für sie auch weniger bedeutsam, dass der Richter ein viel zu mildes Urteil fällt – sie hat ohnehin nicht wirklich zu ihm oder Bryce, sondern zu sich selbst und den Menschen, die in ihrem Leben auch weiterhin wichtig sein sollen, gesprochen.
Und dann ist da noch die Gewaltspirale, deren Eskalation, neben dem Prozess um Hannah, die zweite Haupthandlung der zweiten Staffel darstellt. Es gibt noch immer keine treffendere Beschreibung, als die von Yoda aus Star Wars Episode I: Furcht führt zu Wut. Wut führt zu Hass. Hass führt zu unsäglichem Leid. In Staffel 2 von 13 Reasons Why lernen wir, dass dieser Prozess schon sehr früh begonnen hat. Er beginnt beim kleinen Bryce, dessen Eltern nicht präsent sind, um ihm Grenzen zu setzen und Empathie zu vermitteln. Beim kleinen Justin, der früh mit Minderwertigkeitsgefühlen und drohender Ausgrenzung aufgrund seiner familiären Herkunft zu kämpfen hat, beim kleinen Monty, dessen Vater ihn misshandelt und ihn damit in einer Welt aufwachsen lässt, die sich in Starke und Schwache, Täter und Opfer teilt und in der es sicherer ist, möglichst oft der Starke, der Täter zu sein, um möglichst nicht Opfer zu werden. Bei allen dreien, ja, auch Bryce, ist es das früh gesäte Minderwertigkeitsgefühl, dass es notwendig macht, sich ständig über andere zu erheben, um sich der eigenen Wertigkeit in Form sozialer Abwärtsvergleiche zu versichern: Wenn die anderen klein genug gemacht werden, kann selbst der Unsicherste sich groß und stark fühlen. Was bei Monty und Justin offensichtlich ist – auch bei Marcus, dessen Vater bedingungslosen Ehrgeiz und Erfolg fordert und sich dabei selbst als gleichsam unerreichbares Vorbild geriert – ist der Minderwertigkeitskomplex offensichtlich, bei Bryce weniger. Doch auch seine psychische Entwicklung nimmt Schaden, dadurch dass er keine wirkliche empathische Spiegelung, also ein verlässliches, authentisches, differenziertes Eingehen auf seine Gefühlsäußerungen und sein Verhalten erfährt. Er scheint kaum Möglichkeiten zu haben, sich die Aufmerksamkeit seiner Eltern zu sichern. Alles was er hierfür tut, führt lediglich zur Bewunderung durch andere, auf die es aber zunächst gar nicht ankommt. Auch weil diese Bewunderung vergiftet ist durch seinen sozialen Status. Er kann sich nie sicher sein, ob er als Person gemeint ist, oder nur sein Reichtum, der familiäre Einfluss oder die bloße Angst vor ihm oder seinem Vater. Symptomatisch ist die Szene, in welcher das ganz Stadion seinen Sieg beim Football bejubelt, er jedoch einsam und verloren wirkt, weil niemand da zu sein scheint, der sich auch für ihn interessieren würde, wenn der Erfolg ausbleibt. Seine Eltern hatten mal wieder keine Zeit zum Spiel zu kommen…
Sie alle stabilisieren ihr eigenes, fragiles Selbstwertgefühl auf Kosten anderer, vorzugsweise der vermeintlich Schwächsten, um sich im Vergleich stark und sicher zu fühlen. Viele bekommen das zu spüren, am stärksten Tyler. Je mehr er gemobbt wird, umso unsicherer wird er, was wiederum dazu führt, dass er sozial gehemmt und ungeschickt agiert und sich neuem Spott aussetzt. Auch er beginnt nach Möglichkeiten zu suchen, sich einmal stark und mächtig zu fühlen und verfällt immer stärker Gewaltphantasien. Dabei zeigt auch seine Entwicklung, dass es eben nicht vergeblich ist, sich um andere, die am Rand stehen und sich gegen die Gesellschaft zu wenden drohen, zu kümmern. Immer wieder schöpft Tyler Hoffnung, versucht sich zu integrieren, sich zu öffnen, Freunde und Liebe zu finden. Manchmal ist es Pech, manchmal Zufall, manchmal auch die Boshaftigkeit derer, die ihren Schmerz auf einen Schwächeren projizieren müssen, die Tyler letzten Endes doch immer weiter in die Isolation treiben. Dieser Prozess wird glaubhaft dargestellt. Zum Glück scheint er auch am Ende noch nicht zu Ende zu sein…
HILFE BEI SUIZIDGEDANKEN, MOBBING UND ANDEREN KRISEN FINDEST DU IN DER KLINIK FÜR (KINDER- UND JUGEND-) PSYCHIATRIE IN DEINEM LANDKREIS ODER ANONYM BEI DER TELEFONSEELSORGE!