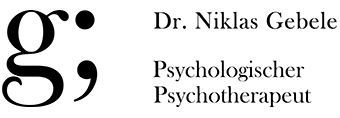Auf ihrem Blog 28years.de schreibt Psychologin Alina über (erwachsene) Kinder suchtkranker Eltern. Für Charakterneurosen nimmt sie die Gallaghers aus der Kultserie Shameless unter die Lupe.
Die US-amerikanische Fernsehserie Shameless zeigt auf eindringliche Weise die zerstörerischen Auswirkungen von Frank Gallaghers Alkoholabhängigkeit. Diese betrifft nicht nur ihn selbst, sondern prägt auch das Leben seiner gesamten Familie.
Jedes Geschwisterkind entwickelt spezifische Bewältigungsstrategien. Einige davon spiegeln typische Verhaltensweisen wider, die oftmals in der Literatur und Forschung über Kinder aus alkoholkranken Familien beschrieben werden.
Fiona Gallagher: Die Familienheldin
Fiona Gallagher ist die älteste Tochter des Gallagher-Clans. Als ihre Mutter Monica die Familie verlässt, als Fiona 16 Jahre alt ist, sieht sie sich gezwungen, die Hauptverantwortung für ihr Zuhause zu übernehmen.
Sie kümmert sich um ihre fünf jüngeren Geschwister und versucht, den durch Franks Alkoholabhängigkeit verursachten Zusammenbruch der Familie abzufedern. Fiona wird zur Ersatzmutter, Versorgerin und zentralen Stütze ihrer Geschwister – eine Rolle, die sie mit bemerkenswerter Entschlossenheit ausfüllt, auch wenn dies bedeutet, ihre eigenen Bedürfnisse und Träume zu opfern.
Ihre Geschwister, und sogar Frank selbst, wenden sich immer wieder an Fiona, wenn sie in Schwierigkeiten stecken. Um die finanziellen Lücken zu schließen, die Franks Untätigkeit und Verantwortungslosigkeit hinterlassen, nimmt Fiona die verschiedensten, oft erniedrigenden Jobs an. Sie übernimmt nicht nur die Haushaltsführung, sondern wird auch zur moralischen und emotionalen Stütze ihrer Familie.
Fionas Rolle innerhalb der Gallagher-Familie entspricht genau dem, was in der Literatur über suchtbelastete Familien als die Rolle des „Familienhelden“ oder der „Verantwortungsbewussten“ beschrieben wird (Wegscheider, 1988; Black, 1988). Der Familienheld übernimmt in dysfunktionalen Familien häufig die Aufgaben und Pflichten, die eigentlich den Eltern zukommen, und versucht, das Leben der Familie so stabil wie möglich zu halten.
Die Tatsache, dass diese Rolle oft dem ältesten Kind zufällt, liegt vor allem daran, dass es aufgrund seines Alters am ehesten der Herausforderung gewachsen ist. Häufig sind sie zudem weiblich, da Frauen und Mädchen durch ihre Sozialisierung stärker auf Care-Arbeit und Verantwortungsübernahme geprägt werden.
Fiona ist also ein Musterbeispiel für das Helden-Kind: Sie hält den Haushalt zusammen und übernimmt die emotionale und praktische Versorgung der Familie. In ihrer Rolle versucht sie zudem, sowohl Frank als auch Monica zu ersetzen, indem sie Ordnung und Stabilität in das ansonsten chaotische Familienleben bringt.
Ein zentraler Aspekt dieser Rolle ist die sogenannte Parentifizierung, eine Rollenumkehr zwischen Eltern und Kind. Fiona wird quasi zur Mutter ihrer jüngeren Geschwister, während Frank für sein Verhalten nicht einmal annähernd Verantwortung übernimmt. Diese Belastung zwingt Fiona dazu, schnell erwachsen zu werden, und lässt ihr wenig Raum für eigene Träume oder ihre persönliche Entwicklung.
Wie von Sharon Wegscheider und Claudia Black beschrieben, ist die Rolle des Familienhelden oft mit einem hohen Maß an Lob und Anerkennung verbunden, was diese Kinder motiviert, noch mehr zu leisten. Fiona erfährt diese Bestätigung indirekt vor allem durch ihre Geschwister. Doch diese Anerkennung hat ihren Preis.
Die Belastung, die mit dieser Rolle einhergeht, führt häufig zu einer Überforderung, der Kinder emotional nicht gewachsen sind. Dies zeigt sich auch bei Fiona: Obwohl sie nach außen hin stark und entschlossen wirkt, zehren die ständigen Anforderungen und der Druck, alles zusammenzuhalten, an ihr und entladen sich manchmal schlagartig, zum Beispiel in einem Substanzmissbrauch.
Dennoch bleibt Fiona ein Symbol für Resilienz und Überlebenswillen. Trotz ihrer schwierigen Ausgangslage gelingt es ihr in späteren Staffeln, ihre alte Rolle abzulegen und ihre eigene Zukunft erfolgreich zu gestalten.
Lip Gallagher: In Franks Fußstapfen
Phillip Ronan „Lip“ Gallagher ist das zweitälteste Kind der Gallagher Familie. In der Serie sticht Lip vor allem durch seine Intelligenz hervor. Mit einem GPA von 4.6 ist er das begabteste Familienmitglied.
Lips außergewöhnliche Intelligenz könnte ihm den Weg aus seinem sozialen Milieu ebnen, doch statt sein Potenzial voll auszuschöpfen, sabotiert er sich selbst immer wieder – sei es durch promiskuitive Beziehungen oder seinen exzessiven Alkoholkonsum.
So wird Lip bereits zu Beginn der Serie oft beim Rauchen von Zigaretten und Marihuana gezeigt. Doch während seiner Zeit am College wird deutlich, dass er auch ein immer problematischeres Verhältnis zum Alkohol entwickelt.
Zu den ersten sichtbaren Folgen gehört der Verlust seiner Stelle in der Studentenvereinigung. Auch seinen Job als Teaching Assistant verliert er aufgrund seines Alkoholkonsums. Langfristig führt Lips destruktives Verhalten schließlich zum Collegeverweis.
Lips Trinkverhalten erfüllt mehrere Kriterien für eine Alkoholabhängigkeit gemäß der ICD-10 (F10.2):
- Starkes Verlangen nach Alkohol: Sein Drang zu trinken ist so stark, dass er ihn nicht kontrollieren kann.
- Kontrollverlust: Lip trinkt übermäßig und hat Schwierigkeiten, seine Konsummenge zu regulieren.
- Fortgesetzter Konsum trotz negativer Konsequenzen: Trotz der gravierenden Auswirkungen auf seine akademische und berufliche Laufbahn setzt er seinen Alkoholmissbrauch fort.
Lips Probleme spiegeln ein typisches Muster wider, das häufig bei Kindern suchtkranker Eltern zu beobachten ist. Kinder aus alkoholbelasteten Familien stellen eine Hochrisikogruppe für Suchterkrankungen dar.
Studien zeigen, dass etwa ein Drittel dieser Kinder im Erwachsenenalter selbst stofflich abhängig wird, und sie haben ein 4-6-fach erhöhtes Risiko für Suchtprobleme im Vergleich zu Kindern aus nicht-suchtkranken Haushalten.
Die Ursachen hierfür sind sowohl genetisch als auch psychosozial:
- Genetische Veranlagung: Alkoholismus ist vererbbar, und Kinder von Alkoholikern tragen eine biologische Anfälligkeit für Suchterkrankungen.
- Chaotisches Umfeld: Suchtprobleme führen häufig zu Instabilität in der Familie, die Kinder extremem Stress aussetzt. Für Lip bedeutete dies, in einem Umfeld aufzuwachsen, das von Vernachlässigung und emotionaler und materieller Unsicherheit geprägt war.
- Frühes Lernen problematischer Bewältigungsstrategien: Kinder wie Lip sehen früh, wie Eltern Alkohol als Mittel zur Stressbewältigung nutzen, und übernehmen diese Muster unbewusst.
Glücklicherweise entscheidet Lip trotz der Parallelen zu seinem Vater, dass er nicht denselben Weg einschlagen will. Nachdem er die verheerenden Folgen seines Alkoholmissbrauchs erlebt hat, sucht er sich schließlich Hilfe. Schließlich gelingt es ihm, sein Leben wieder in geordnete Bahnen zu lenken – wenngleich er nie wieder ein College besuchen wird.
Carl Gallagher: Das Problemkind
Carl Francis Hashish Gallagher ist das zweitjüngste Kind der Gallagher-Familie. Carl wird zu Serienbeginn als das „Problemkind“ der Familie eingeführt. Mit einer Vorliebe für Chaos, Gewalt und Gefahr zeigt er in den frühen Staffeln zahlreiche antisoziale Tendenzen: Er verstümmelt Spielzeug, quält Tiere und hat Schwierigkeiten, Regeln zu akzeptieren.
Im Verlauf der Serie taucht Carl immer tiefer in kriminelle Machenschaften ein. Er wird zum Drogenhändler, arbeitet für lokale Gangs und wird schließlich zu einer Jugendstrafe verurteilt.
Nach seiner Entlassung aus dem Jugendgefängnis nimmt sein antisoziales Verhalten weiter zu: Er verkauft Waffen und adoptiert einen Gangster-Lebensstil, der selbst seiner Familie zunehmend missfällt.
Wie im Beitrag Shameless: Frank & Carl festgestellt, weist Carls Verhalten auf eine Hyperkinetische Störung des Sozialverhaltens (ICD-10: F90.1) hin, die ADHS-Symptome (Unaufmerksamkeit, Hyperaktivität, Impulsivität) mit normverletzendem Verhalten kombiniert. Zu den typischen Merkmalen gehören Wutausbrüche, unüberlegtes Handeln und das Brechen von Regeln – alles Verhaltensweisen, die Carl regelmäßig zeigt.
Studien zeigen, dass Kinder von alkoholkranken Eltern deutlich häufiger eine ADHS haben als Kinder aus unbelasteten Familien (Maher et al., 2023). Zusätzlich zeigen die Kinder eher sogenannte externalisierende Verhaltensweisen (Hussong et al, 2014; Eiden et al., 2007) – das bedeutet, sie reagieren auf inneren Stress und Unsicherheit mit aggressivem, impulsivem oder sozial störendem Verhalten.
Dieses Verhalten ist eine Art emotionaler Schutzmechanismus, der die Kinder kurzfristig durch den Abbau innerer Anspannung entlastet, aber langfristig zu gravierenden Problemen führen kann. So kanalisiert Carl seine Unsicherheiten und die Vernachlässigung durch seine Eltern in destruktive Handlungen, was ihn früh auf einen kriminellen Pfad führt.
Wie Fiona entspricht auch Carl damit einer Rolle, die in der Literatur über Kinder aus suchtbelasteten Familien beschrieben wird: die des „Schwarzen Schafs“ oder „Sündenbocks“ (Wegscheider, 1988; Black, 1988).
Während Fiona auf die familiäre Dysfunktion reagiert, indem sie die Verantwortung für Stabilität und Ordnung übernimmt, verinnerlicht Carl das Chaos der Familie und lebt es durch auffälliges, destruktives Verhalten aus. Durch sein provokatives Verhalten wird Carl zum sichtbaren Symptom der inneren Konflikte innerhalb der Familie.
Antisoziale Verhaltensweisen, wie sie Carl in seiner Jugend zeigt, halten bei Kindern alkoholkranker Eltern oftmals bis ins Erwachsenenalter an (Harter, 2000). Doch Carl gelingt es, den gefährlichen Pfad zu durchbrechen. Nach einem traumatischen Vorfall, der ihm die Konsequenzen seines kriminellen Lebensstils vor Augen führt, beginnt er, seine Zukunft neu zu überdenken.
Er entscheidet sich, eine Militärschule zu besuchen, wo er Disziplin und Struktur kennenlernt – etwas, das ihm in seiner Kindheit gefehlt hat. Diese Erfahrungen formen ihn zu einem gereiften jungen Mann, der schließlich den Weg zum Polizisten einschlägt – und dort die Fähigkeiten, die ihn einst in Schwierigkeiten brachten, nutzt, um Gutes zu bewirken.
Ingesamt zeigen die Geschichten der Gallagher-Kinder eindrucksvoll, wie sich die Schatten elterlicher Suchterkrankungen auf die nachfolgenden Generationen auswirken können. Doch trotz der Herausforderungen, die Fiona, Lip und Carl bewältigen müssen, sind sie auch ein Beispiel für Resilienz, Einfallsreichtum und die Kraft, sich selbst neu zu erfinden.
Jeder von ihnen geht seinen eigenen, oft steinigen Weg, doch sie alle beweisen, dass Veränderung möglich ist – sei es durch das Streben nach einem besseren Leben, den Mut, Verantwortung für das eigene Handeln zu übernehmen, oder durch die Fähigkeit, aus Fehlern zu lernen. Shameless zeigt uns, dass selbst in den widrigsten Umständen die Chance auf Wachstum und eine bessere Zukunft besteht.
___________________________
Quellen für Fiona:
Caritas Augsburg. (o. D.). Rollenmuster. Abgerufen am 10. Januar 2025, von https://www.caritas-augsburg.de/hilfeberatung/suchtberatungbehandlungundkrankenhilfe/kiasu-projekt/rollenmuster/rollenmuster
BKK Bundesverband. (2007, Juli). Kindern von Suchtkranken Halt geben – durch Beratung und Begleitung: Leitfaden für Multiplikatoren. NACOA Deutschland. Abgerufen am 10. Januar 2025, von https://nacoa.de/sites/default/files/images/stories/pdfs/freundeskreise%20multiplikatorenleitfaden.pdf
Fandom. (o. D.). Fiona Gallagher (US) – Season 6. Abgerufen am 10. Januar 2025, von https://shameless.fandom.com/wiki/Fiona_Gallagher_(US)#Season_6
Quellen für Lip:
NACOA Deutschland. (o. D.). Fakten und Zahlen. Abgerufen am 10. Januar 2025, von https://nacoa.de/infos/fakten/zahlen
Fandom. (o. D.). Lip Gallagher (US). Abgerufen am 10. Januar 2025, von https://shameless.fandom.com/wiki/Lip_Gallagher_(US)
Quellen für Carl:
Eiden, R. D., Edwards, E. P., & Leonard, K. E. (2007). A conceptual model for the development of externalizing behavior problems among kindergarten children of alcoholic families: role of parenting and children’s self-regulation. Developmental psychology, 43(5), 1187–1201. https://doi.org/10.1037/0012-1649.43.5.1187
Maher, B.S., Bitsko, R.H., Claussen, A.H. et al. Systematic Review and Meta-analysis of the Relationship Between Exposure to Parental Substance Use and Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder in Children. Prev Sci 25 (Suppl 2), 291–315 (2024). https://doi.org/10.1007/s11121-023-01605-2