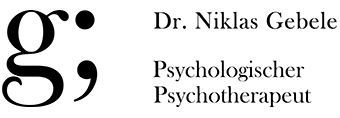Die Star Trek Filme von J. J. Abrams, Star Trek (2009) und Star Trek Into Darkness (2013), rücken das Kennenlernen und die beginnende Freundschaft der beiden Hauptcharaktere Captain James T. Kirk und Commander Spock in dem Mittelpunkt der Handlung.
Wenngleich die beiden eigentlich viel gemeinsam haben (Stolz, beruflicher Ehrgeiz, Verlust eines Elternteils, Schwäche für Lieutenant Uhura…), wird vor allem ihr unterschiedlicher, ja gegensätzlicher Umgang mit Emotionen thematisiert und sorgt immer wieder für Diskussionen und Konflikte zwischen beiden.
Spock, der halb Mensch, halb Vulkanier ist, wurde nach vulkanischem Brauch erzogen. Wie wir von Spocks Vater lernen, haben Vulkanier nicht etwa keine oder weniger Emotionen als Menschen, sondern im Gegenteil, viel stärkere. Durch Wissen und Logik versuchen sie, ihre Emotionen zu kontrollieren, um nicht von ihnen kontrolliert zu werden. Die Indoktrination mit der vulkanischen Philosophie beginnt von klein auf, sodass Spock niemals lernte, Emotionen wahrzunehmen, zu differenzieren oder zu regulieren, sondern nur, sie radikal zu unterdrücken.
Diesen, von den Vulkaniern angestrebten Zustand kennt die Psychologie als psychopathologisches Symptom mit dem Namen Alexithymie, was so viel bedeutet wie Unfähigkeit zum Gefühlsausdruck.
Alexithymie kommt durch Verdrängung zustande. Verdrängung wiederum ist ein psychischer Abwehrmechanismus, mit dem sich das Ich vor unaushaltbaren Emotionen schützt, indem diese ins Unbewusste verdrängt werden. Verdrängung kann komplette Erinnerungssequenzen, z. B. traumatische Erlebnisse, betreffen, oder auch nur die Gefühle, die mit einem Erlebnis verknüpft sind. Im letzteren Fall spricht man auch von Affektisolierung. Diese liegt der Alexithymie zugrunde, bei der die Personen zwar über schmerzhafte Erlebnisse berichten können, aber scheinbar ohne emotionale Beteiligung.
Am Beispiel von Spock, der den Prozess der Verdrängung, welcher beim Menschen in der Regel unwillkürlich und unbewusst abläuft, aktiv trainiert und praktiziert, können wir beobachten, dass Verdrängung nicht mit vollständigem Vergessen oder Löschen gleichzusetzen ist. Spocks Emotionen (sowohl die aktuellen, wie auch die Erinnerungen an vergangene, besonders schmerzhafte) sind in den Tiefen seines Bewusstseins weiter vorhanden und können unvermittelt hervorbrechen, zum Beispiel wenn er provoziert wird.
Es wird deutlich, dass die Verdrängung von Gefühlen und die Fokussierung auf Logik und Rationalität Spocks Leistung im beruflichen Alltag verbessert und ihm dadurch kaum Fehler unterlaufen.
Diese funktionale Komponente macht den psychischen Abwehrmechanismus der Verdrängung auch für uns Menschen so wichtig, da er uns ermöglicht, rational, konsequent und zielorientiert Leistung zu erbringen, wenn es sein muss, und unseren Affekten und Impulsen nicht ständig ausgeliefert zu sein.
Dies ist jedoch auf Dauer anstrengend und wenn es nicht gelingt, Ventile für die (vorrübergehend) verdrängten Gefühle zu schaffen (Genuss, Spiel, Entspannung, oder die bewusste Auseinandersetzung mit ihnen – aus vulkanischer Sicht allesamt unlogisch…), steigt der innere Druck und kann, wie bei Spock, zu umso heftigeren spontanen Gefühlsausbrüchen kommen, oder, wie häufig bei alexithymen Patienten, zu körperlichen Symptomen und Schmerzen infolge der psychischen Anspannung.
Darüber hinaus unterschätzt Spock die soziale Funktion von Emotionen. Seine radikale Affektisolierung, macht ihn für sein (menschliches) Umfeld suspekt, für Rivalen (Kirk) und Feinde (Khan) berechenbar und für seine Freundin (Uhura) unnahbar. Indem er den Kontakt zu seinen Gefühlen blockiert, trennt er die Verbindung zu seinen Mitmenschen, die zu großen Teilen auf emotionsbasierter verbaler und nonverbaler Kommunikation beruht.
Erst als er anfängt zu seinen Gefühlen zu stehen und sie zunehmend zuzulassen wird er von den Seinen akzeptiert (offenbar auch von den Vulkaniern, denn schließlich wird er später deren Botschafter) und kann seine Feinde besiegen.
Wenn Spock (zunächst) das Extrem von Logik, Besonnenheit und der Unterdrückung von Gefühlen verkörpert, stellt Kirk in diesem Punkt seinen diametralen Gegenpol dar. Rationalität und Reflektion sind seine Sache nicht. Häufig handelt er, anstatt nachzudenken und hört dabei auf sein Bauchgefühl.
In Ausnahmesituationen und angesichts scheinbar übermächtiger (aber selbst nicht rational handelnder) Gegner und aussichtsloser Lagen, hat er damit, dank maximalen Einsatzes, hohen Risikos und des Überraschungsmoments oft Erfolg.
Allerdings ist auch er in seinem Verhalten wenig flexibel und zeigt daher auch im Alltag ein von Emotionalität und Impulsivität geprägtes Verhalten, welches ihn hier wiederholt in beträchtliche Schwierigkeiten bringt.
Es entsteht der Eindruck, dass Kirk Emotionen nicht nur nicht vermeidet, sondern im Gegenteil vielmehr ständig auf der Suche nach möglichst intensiven Erfahrungen und Gefühlen ist. Er ist das, was die Psychologie einen Sensation Seeker nennt. Ebenso wie bei der Alexithymie handelt es sich bei Sensation Seeking nicht um eine Krankheit, sondern um eine Verhaltenstendenz, die, je nach Ausprägung, mehr oder weniger Beeinträchtigungen der Alltagsfunktionalität und des Wohlbefindens mit sich bringen kann.
Sensation Seeking kann sich beispielsweise anhand folgender Verhaltensweisen äußern:
- Suche nach Spannung und Abenteuer durch riskante Aktivitäten wie z. B. Extremsport, schnelles Fahren etc.
- Suche nach neuartigen, ungewohnten Erfahrungen, z.B. durch einen nonkonformistischen Lebensstil
- Tendenz zur Enthemmung, z. B. durch promiskuitives Verhalten oder Rauschmittel
- Unfähigkeit, Monotonie oder Langeweile auszuhalten
Kirk hatte bereits als Kind ein Faible für schnelle Autos und Regelübertretungen. Er pflegt ganz und gar nicht den Lebensstil, der allgemein für einen Sternenflottenoffizier als angemessen erachtet wird. Seine Freizeit verbringt er bevorzugt mit Saufen, Kneipenschlägereien und sexuellen Affären mit möglichst exotischen Geschöpfen anderer Spezies. Die Aussicht, bei irgendeinem gefährlichen Einsatz nicht an vorderster Front mitzumischen, scheint für ihn nahezu unerträglich zu sein.
Die Tendenz zum Sensation Seeking ist wahrscheinlich überwiegend genetisch determiniert. Sensation Seeker haben an sich ein eher geringes Grunderregungsniveau (im Gegensatz also zu Vulkaniern!) und benötigen daher starke äußere Reize, um ein angenehmes Maß an Stimulation zu empfinden (sonst drohen Unterforderung und Langeweile).
Hinzu kommt, dass Kirk ohne seinen Vater, dafür aber in dessen übermenschlich heldenhaftem Schatten aufgewachsen ist. Damit ist er von klein auf zum Heldentum verdammt, Mittelmaß und Normalität sind gleichbedeutend mit Versagen.
Dieser narzisstische Konflikt, der Beste sein zu müssen, oder sich als Versager zu fühlen, treibt Kirk beständig dazu an, Rekorde zu brechen, das Unmögliche zu versuchen, sich über Regeln und Wahrscheinlichkeiten hinwegzusetzen.
Da er als Kind nur eine Heldenschablone, aber keinen echten Vater hatte, der ihm Anleitung gab und Grenzen setzte, empfindet er, der zu Großem Geborene, das später fast immer als Kränkung und hat ständig Schwierigkeiten mit Autoritäten.
So ist Kirk mit seinem Alltag als Mitglied eines hierarchischen Militärapparates chronisch überfordert, während er in Ausnahmesituationen, welche die meisten Menschen vor Angst lähmen würden, zu Hochform aufläuft.
Der Streit zwischen Kirk und Spock darüber, ob der Weg des Bauchgefühls oder der Logik der bessere ist, bleibt letztlich unentschieden. Wichtiger scheint zu sein, dass sich beide im selben Moment der Grenzen ihrer jeweiligen Strategien bewusst werden: Als der Macher Kirk (am Ende von Star Trek Into Darkness) alles ihm Mögliche getan hat und alle retten konnte, außer sich selbst, wird er sich seiner Sterblichkeit und der Tatsache bewusst, dass er doch nicht über allen Gesetzen der Wahrscheinlichkeit steht und er bekommt, vermutlich erstmals seit langem, bewusst Angst. Von Spock, dessen Rationalismus sich über die Niederungen der menschlichen Gefühle erhoben zu haben scheint, will er wissen, wie man es schafft keine Angst zu empfinden, doch Spock muss in ebendiesem Moment erkennen, dass er gegen die Angst um seinen Freund, zu dem er nur unfreiwillig eine emotionale Bindung aufgebaut hat, ebenso machtlos ist.
In diesem Sinne können wir die Freundschaft zwischen Spock und Kirk und die Veränderung der beiden durch ihre Freundschaft, als Hinweis zum Umgang mit der uns allen eigenen, innerpsychischen Dialektik von Denken und Fühlen, von Verdrängen und Annehmen, von Reflektieren und Agieren sehen.
Es geht, könnten uns die Filme sagen wollen, nicht darum, die eine Position zugunsten der anderen gänzlich aufzugeben, so wie Kirk und Spock zunächst versuchen, über den jeweils anderen zu triumphieren und ihn so von der Überlegenheit des eigenen Ansatzes zu überzeugen.
Vielmehr liegt der Schlüssel zum Erfolg darin, die Stärken beider Ansätze zu nutzen, ihre Grenzen anzuerkennen und sie situationsangemessen bestmöglich komplementär einzusetzen. Faszinierend!