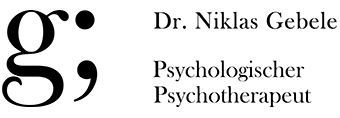Suicide Squad: Harley Quinn
- gesteigerte Aktivität, motorische Ruhelosigkeit
- gesteigerte Gesprächigkeit, Rededrang
- Verlust sozialer Hemmungen, unangemessenes Verhalten
- überhöhte Selbsteinschätzung
- Ablenkbarkeit
- Tollkühnes oder leichtsinniges Verhalten ohne Risikobewusstsein
- Gesteigerte Libido oder sexuelle Taktlosigkeit
Hand of God: Pernell
- Wahn
- Akustische Halluzinationen in Form von kommentierenden und dialogischen Stimmen
- Optische Halluzinationen
- Gedankeneingebung: Überzeugung dass eigene Gedanken von außen (von Gott) geschickt wurden
- Gedankenabreisen: Unterbrechung des Denkflusses (bei Pernell durch das plötzliche Einschießen von Einfällen im Zusammenhang mit seinem Wahn)
Terminator 2: Sarah Connor
Sarah Connor gilt, insbesondere in Terminator 2 – Tag der Abrechnung, als eine der stärksten weiblichen Heldenfiguren des Actionkinos. Dennoch befindet sie sich zu Beginn des Films in einer überaus hilflosen Lage, nämlich zwangseingewiesen in einer geschlossenen forensischen Psychiatrie.
- Symptomen einer Schizophrenie, z.B. Wahn und
- Symptomen einer Affektiven Störung, also entweder
- einer Depression (gedrückte Stimmung, Freudlosigkeit, Antriebsminderung) oder
- einer Manie (situationsunangemessen gehobene Stimmung, Gereiztheit, Antriebssteigerung, Größenwahn)
- Ein Erlebnis von außergewöhnlicher Bedrohung, z.B. von einem Terminator gejagt und mehrfach fast getötet zu werden
- Anhaltende Erinnerungen an das traumatische Erlebnis oder wiederholtes Erleben des Traumas in sich aufdrängenden Erinnerungen, z.B. Tagträume vom Ende der Welt
- Innere Bedrängnis in Situationen, die der Belastung ähneln oder damit in Zusammenhang stehen, z.B. unverhofft auf der Flucht aus dem Krankenhaus auf genau das Terminator-Modell zu treffen, von welchem man gejagt und mehrfach fast getötet wurde
- Erhöhte psychische Sensitivität und Erregung, z.B. Gereiztheit, Schreckhaftigkeit, erhöhte Wachsamkeit, Impulsivität…
Fight Club & Zwielicht
Beide Filme behandeln, jeweils anhand der von Edward Norton dargestellten Charaktere, das Thema gespaltene Persönlichkeit, oder, im psychologischen Fachjargon Multiple Persönlichkeitsstörung, welche nach IDC-10 (F44.81) wie folgt beschrieben wird:
- Zwei oder mehr unterschiedliche Persönlichkeiten innerhalb eines Individuums, von denen zu einem bestimmten Zeitpunkt jeweils eine in Erscheinung tritt
- Jede Persönlichkeit hat ihr eigenes Gedächtnis, ihre eigenen Vorlieben und Verhaltensweisen und übernimmt zu einer bestimmten Zeit, auch wiederholt, die volle Kontrolle über das Verhalten der Betroffenen
- Unfähigkeit, wichtige persönliche Informationen zu erinnern (zu ausgeprägt für eine einfache Vergesslichkeit)
- Nicht bedingt durch eine hirnorganische Störung oder durch psychotrope Substanzen
- Überzeugender zeitlicher Zusammenhang zwischen den Symptomen und belastenden Ereignissen, Problemen oder Bedürfnissen
In Fight Club spielt Edward Norton den namenlosen Protagonisten, der in der Rezeption häufig Jack genannt wird (im Bezug auf die Zeitschriftenartikel aus der Perspektive der inneren Organe einer Person namens Jack), und der wahrscheinlich die prämorbide Grundpersönlichkeit darstellt. Auf andauernde Gefühle von Sinnlosigkeit und Einsamkeit reagiert Jack zunächst mit heftigen Schlafstörungen (ICD-10: F51.0, Nichtorganische Insomnie), die ihn noch weiter an die psychische und physische Belastungsgrenze bringen. Die letzte Rettung für seine dem Zusammenbruch nahe Psyche ist die Dissoziation eines Persönlichkeitsanteils, den Jack bisher nicht ausleben konnte, wahrscheinlich aufgrund von Angst, Scham und einer Erziehung und Sozialisation, die Anpassung, Unterordnung und den Rückzug in eine materiell-private pseudoheile Welt propagiert haben. Dieser Persönlichkeitsanteil, gespielt von Brad Pitt, heißt Tyler Durden und verkörpert nach eigener Aussage „all das was du immer sein wolltest…„, was in erster Linie Autonomie, Impulsivität, aggressive und sexuelle Exzessivität und grenzenloses Selbstvertrauen bedeutet. Jack leidet, wie er in einer Szene berichtet, darunter, seinen Vater kaum gekannt zu haben und nur von Frauen erzogen worden zu sein. Mit Tyler lebt er sein idealisiertes männlich-kraftvolles Persönlichkeitsideal aus. Die Abspaltung dieses Persönlichkeitsanteils ist zunächst noch notwendig, weil Jack zu tief in seinen Ängsten und Unsicherheiten gefangen ist, um bewusst Veränderungsschritte einleiten zu können.
Ein ähnlicher Zusammenhang besteht im Film Zwielicht zwischen den beiden Persönlichkeitsanteilen Aaron und Roy (diesmal beide gespielt von Edward Norton), wenngleich sich zum Schluss herausstellt, dass, anders als es zunächst den Anschein hatte (und auch anders als in Fight Club), nicht der unsichere, ängstliche Aaron die prämorbide Grundpersönlichkeit verkörpert, sondern dass dieser eine bloße Erfindung des aggressiven und manipulativen Roy, der in Wahrheit doch nicht unter einer multiplen Persönlichkeitsstörung leidet, ist.
Zudem besteht ein Unterschied zwischen den beiden Filmen darin, dass Aaron und Roy nie gleichzeitig auftreten, was, wenngleich sich Roy als Simulant entpuppt, die realistischere Darstellung der multiplen Persönlichkeitsstörung ist, während die ausführlichen Dialoge zwischen Jack und Tyler eher an visuelle und akustische Halluzinationen erinnern, wie sie beispielsweise im Rahmen einer Paranoiden Schizophrenie (ICD-10: F20.0) typisch sind und weniger bei multipler Persönlichkeitsstörung.
Ein anderes Störungsbild, welchem in beiden Filmen eine zentrale Rolle zukommt, ist die Dissoziale Persönlichkeitsstörung. Diese ist nach ICD-10 (F60.2) gekennzeichnet durch:
- Herzloses Unbeteiligtsein gegenüber den Gefühlen anderer
- Deutliche und andauernde verantwortungslose Haltung und Missachtung sozialer Normen, Regeln und Verpflichtungen
- Unfähigkeit zur Aufrechterhaltung dauerhafter Beziehungen, obwohl keine Schwierigkeit besteht, sie einzugehen
- Sehr geringe Frustrationstoleranz und niedrige Schwelle für aggressives, einschließlich gewalttätiges Verhalten
- Fehlendes Schuldbewusstsein oder Unfähigkeit, aus negativer Erfahrung, insbesondere Bestrafung, zu lernen
- Deutliche Neigung, andere zu beschuldigen oder plausible Rationalisierungen anzubieten für das Verhalten, durch welches die Betreffenden in Konflikt mit der Gesellschaft geraten sind
Dies führt zu einer weiteren Gemeinsamkeit beider Filme: Die Darstellung (vermeintlich) dissoziativ gestörter Hauptcharaktere hat auch die Funktion des Hinweises auf dissoziative Elemente im gesamtgesellschaftlichen Geschehen.
In Zwielicht wird der simulierten Persönlichkeitsspaltung des wegen Mordes angeklagten Aaron/Roy die ihrerseits an Persönlichkeitsspaltung grenzende Bigotterie der herrschenden Klasse gegenübergestellt und die durchweg selbstsüchtigen, macht-, ruhm-, geldgierigen und perversen Motive der nach außen hin makellos anständigen Würdenträger aus Gesellschaft, Justiz und Kirche werden vorgeführt.
Fight Club thematisiert ausführlich die dissoziative Gefühlsabspaltung als Massenphänomen in einer Gesellschaft, die durch permanenten materiellen und medialen Passivkonsum und das axiomatische Gebot von Konformität und Selbstoptimierung in einem hypnotischen Zustand geduldeter Unterwerfung und Gefügigkeit gehalten werden soll, welcher wiederum (und hier schließt sich der Kreis) im eigensten Interesse der, in Zwielicht charakterisierten, herrschenden Minderheit sein soll.
Summa Summarum ist Roy ein kaltblütiger Mörder und Tyler ein Extremist und Terrorist. Einen Anstoß, dissoziative Phänomene im eigenen Alltagserleben wahrzunehmen und die Maximen der eigenen Lebensführung einer Überprüfung zu unterziehen, können uns die Filme dennoch liefern.
Dexter: Dexter
Dexters Drang zu morden begleitet ihn bereits seit der Kindheit und war offenbar niemals über längere Zeit erloschen. Dabei ist er durchaus in der Lage, die Umsetzung für einige Zeit aufzuschieben, zum Beispiel um nach einem geeigneten Opfer zu suchen oder eine günstige Gelegenheit abzuwarten. Dadurch wächst jedoch seine innere Anspannung und es fällt ihm immer schwerer, sich zurückzuhalten. Seine Gedanken engen sich zunehmend auf das Töten ein, bis es ihm kaum noch möglich ist, sich auf anderes zu konzentrieren, um in seinem Alltag zu funktionieren. Mit der Zeit hat er ein festes Ritual entwickelt, das er bei der Tötung seiner Opfer zumeist rigide befolgt und dessen Einhaltung einen maßgeblichen Teil seiner Befriedigung und Erleichterung durch das Morden ausmacht. Wenngleich Dexter seinen Drang als „dunklen Begleiter“ bezeichnet, ist er sich doch im Klaren darüber, dass er aus seinem Inneren, seiner eigenen Psyche entspringt und nicht etwa auf mystische oder magische Weise von außen eingegeben ist. Ebenso realisiert Dexter, dass sein Verhalten extrem ist und von fast allen anderen Menschen nicht akzeptiert, geschweige denn verstanden werden würde. Dexter ist nicht in der Lage, das Morden aufzugeben, wenngleich er dadurch immer wieder in extrem bedrohliche Situationen gerät: Mehrfach steht er kurz davor, erwischt zu werden, was in Florida die Todesstrafe bedeuten würde. Auch Personen die ihm nahe stehen, werden durch seine Aktivitäten gefährdet, mitunter sogar getötet. Nicht zuletzt ist er durch sein Doppelleben permanent extremem Zeitstress und chronischem Schlafmangel ausgesetzt.
Damit können wir Dexter eine Zwangsstörung, bei der Zwangshandlungen, sogenannte Zwangsrituale, im Vordergrund stehen (ICD-10: F42.1), diagnostizieren. Diese ist durch die folgenden Kriterien definiert:
- Zwangsgedanken und/oder Zwangshandlungen treten über einen Zeitraum von mindestens zwei Wochen an den meisten Tagen auf
- Sie werden als Produkte des eigenen Geistes erkannt und nicht als von Personen oder äußeren Einflüssen eingegeben betrachtet
- Sie treten wiederholt auf, werden als unangenehm und zumindest teilweise unangemessen erlebt
- Der Betroffene versucht, sie zu unterdrücken. Mindestens ein Zwangsgedanke oder eine Zwangshandlung kann nicht erfolgreich unterdrückt werden
- Die Zwangshandlung ist an sich nicht angenehm (dies ist zu unterscheiden von einer vorübergehenden Erleichterung von Anspannung oder Angst)
- Die Zwangsgedanken oder Zwangshandlungen verursachen Beschwerden oder soziale Probleme
Erstens war Dexters Mutter akut drogenabhängig. Dies, sowie ihr krimineller Umgang und die Affäre mit einem verheirateten, notorisch fremdgehenden Polizisten, für den sie gleichzeitig als Informantin tätig war, sprechen für eine nicht allzu gefestigte psychische Struktur. Folglich dürften Dexters frühe Beziehungserfahrungen oftmals verwirrend, ängstigend, enttäuschend und verunsichernd gewesen sein, weshalb wir annehmen können, dass seine psychische Struktur zur Zeit des Traumas bereits fragiler und somit störungsanfälliger war, als die von durchschnittlichen Dreijährigen.
Zweitens wurde Dexters Verarbeitung des traumatischen Erlebnisses über Jahre hinweg von seinem Ziehvater Harry, einem Cop alter Schule, geprägt. Dieser enthielt ihm psychotherapeutische Hilfe vor und vermittelte ihm stattdessen sein klassisch dichotomes Verständnis von gut und böse. Unablässig betrieb er die Abspaltung des traumatisierten Anteils als böses „Monster“, welches in Dexters Innerem lauern und in Form des Drangs zu töten an die Oberfläche drängen würde. Er hielt dieses Monster für nicht kontrollierbar und sah somit die einzige Möglichkeit der Schadensbegrenzung für Dexter und die Allgemeinheit darin, den Impuls wenigstens auf die, aus seiner Sicht, richtigen Opfer zu lenken.
Wir dürfen annehmen, dass Harry damit auch eigene Fantasien, die Bösen jenseits gerichtlicher Bürokratie gerecht bestrafen zu können, auf Dexter projizierte.
Dadurch blieb Dexter die Möglichkeit, seine Gefühle und Impulse besser zu verstehen und dadurch das Trauma adäquat zu verarbeiten, verwehrt. In einer Therapie hätte er lernen können zu begreifen, dass durch den brutalen Mord an seiner Mutter seine kindliche Welt in ihren Grundfesten erschüttert wurde. Nichts konnte mehr als sicher gelten. Seine eigene Existenz, sowie alles was er liebte und brauchte, waren in einer Welt, in der etwas so schreckliches geschehen konnte, fundamental bedroht.
Diese Wahrnehmung kann die Seele eines Dreijährigen nicht verkraften, weshalb Dexters Psyche verschiedene Abwehrmechanismen einsetze um ihre Funktionalität irgendwie aufrecht zu erhalten: Erstens spaltete Dexter die Erinnerung an das Trauma über viele Jahre komplett ab, verdrängte das Erlebnis ins Unbewusste. Zweitens, quasi als Schutz vor eventuell doch ans Licht kommenden Erinnerungen, identifizierte sich Dexter unbewusst mit der einzigen Person, die angesichts der unfassbaren Gewalttat nicht um ihr Leben fürchten musste: Dem Mörder.
Das Dilemma, dass die einzige Sicherheit gebende Identifikationsfigur gleichzeitig auch zutiefst ängstigend und verhasst war, wurde durch eine nur unvollständige, gleichsam widerwillige Identifikation gelöst. Psychoanalytiker sprechen von einem „Täterintrojekt“: Dexter nimmt selbst die Rolle des Mörders ein und kann somit (gefühlt) nicht mehr zum Opfer werden.
Gleichzeitig erlebt er den Impuls zu morden aber als etwas störendes, falsches, eigentlich nicht zu ihm passendes. Er legt größten Wert darauf, sich von den anderen Mördern, die Unschuldige umbringen, zu unterscheiden und bringt sie, stellvertretend für den nicht internalisierten Teil des Mörders seiner Mutter, immer wieder um.
Dexter wurde also Opfer, machte sich, um die Opferrolle zu verlassen, selbst zum Täter, und vermeidet die Schuldgefühle eines Täters, indem er die Schuld auf andere Täter projiziert, die er dann zu gerechten Opfern macht.
Die Komplexität dieser Abwehrkonstruktion lässt bereits vermuten, dass das nie lange gut gehen kann. Und tatsächlich, nach jedem Mord dauert es nicht lange, bis der Zwang sich wieder meldet und unaufhaltsam auf Umsetzung drängt. All die verdrängten Gefühle (Angst vor der Destruktivität der Welt, Trauer um die Mutter, Hass auf deren Mörder, Schuldgefühle wegen der eigenen Täterschaft…) drängen ins Bewusstsein und drohen, Dexters sensibles psychisches Gleichgewicht zu zerstören, was ihn immer wieder dazu zwingt, dieses wieder in Ordnung zu bringen.
In seinem Tötungsritual wird das eindrucksvoll deutlich:
- Der ganze Raum wird sorgfältigst mit Plastikfolie ausgekleidet: Das Morden ist hier sauber, fast ein Akt der Reinigung, schmutzig sind die anderen Mörder – nicht Dexter.
- Vor ihrem Tod werden die Opfer mit den Opfern ihrer eigenen Gräueltaten konfrontiert: Dem Bösen wird damit ein fester Ort zugewiesen. Es ist im Anderen zu Hause, nicht bei Dexter.
- Dexter behält von jedem Opfer einen Blutstropfen auf einem Objektträger, welche er, fein säuberlich geordnet, in seiner Wohnung aufbewahrt: Das Opfer wird damit zur Fallnummer, zu einem Stück DNS unter vielen, somit entmenschlicht. Dexter ist ein Sammler, ein Wissenschaftler, so einer ist nicht wirklich böse. Brutale Mörder, und damit schuldig, sind die Anderen.