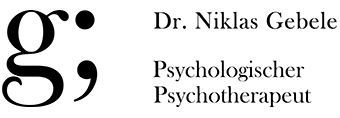Zu Suicide Squad ist ja von Kritikerseite bereits alles gesagt. Auch die Geschichte der Psychiaterin, die dem Joker verfällt, derentwegen ich mir den Film, trotz der (zu Recht) vernichtenden Kritiken, angesehen habe, wird nur oberflächlich behandelt.
Was wir dennoch erfahren, ist, dass Dr. Harleen Quinzel, die spätere Harley Quinn, im Arkham Asylum (der legendären forensischen Psychiatrie Gotham Citys) offenbar psychotherapeutische Gespräche mit dem Joker führte, in deren Rahmen sie sich immer mehr in ihn verliebte. Ein beliebtes Motiv, das zeigt, dass die psychotherapeutische Beziehung, ihre Beschaffenheit, Regeln und Grenzen, Autoren nachhaltig interessieren.
In Film und Fernsehen wird die therapeutische Beziehung dem hohen Anspruch, einerseits echte intensive Gefühle und tiefes Vertrauen hervorzubringen und gleichzeitig streng auf die Therapie und deren Ziele begrenzt zu bleiben, oft nicht gerecht. So ergab die Auswertung von über 100 Filmen*, in denen Psychotherapeuten vorkamen, dass diese in 45% der Fälle die Grenzen des therapeutischen Rahmens überschritten. Etwa die Hälfte der Grenzüberschreitungen war sexueller Natur.
In der Realität sind solche schweren therapeutischen Kunstfehler zum Glück seltener, wenngleich sie natürlich vorkommen. Gelingt es, eine gute, konstruktive und tragfähige therapeutische Beziehung aufzubauen, ist diese einer der wichtigsten, in manchen Studien sogar der wichtigste Wirkfaktor erfolgreicher Psychotherapien. „Gut“ ist die therapeutische Beziehung dann, wenn Therapeut und Patient sowohl wohltuende, Vertrauen und Sicherheit fördernde Nähe aufbauen, als auch das Geschehen innerhalb und außerhalb der Therapiesitzungen analytisch reflektieren und zwischen diesen beiden Ebenen flexibel hin- und herwechseln können. Um nicht in die Gefahr zu geraten, dauerhaft zu einseitig zu agieren, also sich zum Beispiel zu unreflektiert auf die positiven Gefühle gegenüber dem Patienten einzulassen und sich in Rettungs- oder Liebesphantasien zu verlieren, praktizieren Psychotherapeuten in den ersten Jahren ihrer Tätigkeit nur unter Supervision erfahrener Kollegen, denen sie regelmäßig über den Therapieverlauf berichten.
Dies scheint Dr. Quinzel versäumt zu haben, weshalb niemand intervenieren kann, als sie sich mehr und mehr in ihren manipulativen Patienten verliebt und diesem schließlich zur Flucht verhilft.
Im Rahmen des Ausbruchs kommt es zu einer eigenartigen Szene: Obwohl Harley dem Joker bereits verfallen und ergeben zu sein scheint, lässt er sie überwältigen und verabreicht ihr Elektroschocks. Es wirkt, als sei der Joker mit der Elektrokrampftherapie (EKT), bei welcher mittels Stromstößen gezielt Krampfanfälle des Gehirns ausgelöst werden, vertraut.
Vermutlich wurde er ihr selbst in Arkham gegen seinen Willen unterzogen. Indem er nun Harley dasselbe antut, wehrt er das Gefühl des passiven Opfers ab und projiziert es auf Harley, um sich selbst wieder aktiv, stark und wehrhaft fühlen zu können. Es ist einer von mehreren grausamen Akten des Jokers, die alle dazu dienen, Harley zu dem irren, albernen aber auch unheimlichen Freak zu machen, als welcher er selbst von allen anderen gesehen wird.
In unserer Realität wird EKT tatsächlich zur Behandlung schwerer Depressionen und Schizophrenien eingesetzt, wenn psychotherapeutische und medikamentöse Behandlungsversuche erfolglos bleiben. Allerdings nur, wenn der Patient dem zustimmt.
Die durch die elektrischen Impulse ausgelösten Krampfanfälle des Gehirns stoßen dabei dessen Selbstheilungskräfte an, so dass bestimmte Botenstoffe wieder ins Gleichgewicht gebracht und neuronale Verbindungen quasi repariert werden können.
Bei Harley Quinn, die vor der EKT keine psychiatrischen Symptome zeigt, ist diese selbstverständlich absolut kontraindiziert und erwirkt somit auch eine geradezu paradoxe Reaktion: Die EKT löst bei Harley deutliche Symptome einer Manie aus. Diese affektive (= die Stimmung betreffende) Störung, kann sich nach der internationalen Klassifikation psychischer Störungen (ICD-10: F30.2) unter anderem äußern durch:
- gesteigerte Aktivität, motorische Ruhelosigkeit
- gesteigerte Gesprächigkeit, Rededrang
- Verlust sozialer Hemmungen, unangemessenes Verhalten
- überhöhte Selbsteinschätzung
- Ablenkbarkeit
- Tollkühnes oder leichtsinniges Verhalten ohne Risikobewusstsein
- Gesteigerte Libido oder sexuelle Taktlosigkeit
Darüber hinaus kann eine manische Episode mit psychotischen Symptomen (Wahn, Halluzinationen) einhergehen, was Harley andeutet, wenn sie berichtet, Stimmen zu hören oder sich nicht sicher ist, ob es sich bei Enchantress um eine optische Halluzination handelt.
Somit unterscheidet sich Harley, bei aller Liebe und äußerlichen Ähnlichkeit, vom Joker. Während dessen Fröhlichkeit nur Sarkasmus ist, ein Stilmittel, welches seinen Zorn noch grausamer wirken lässt, ist Harleys Stimmung, infolge der Manie, tatsächlich gehoben. Sie genießt weniger die Grausamkeit, als vielmehr die Action um ihrer selbst willen. Während der Joker planmäßig handelt, um andere, meist Batman, zu provozieren, tut und sagt Harley impulsiv wonach ihr ist und hat wenig Gespür und kaum Interesse für die Konsequenzen. Der Joker möchte Angst verbreiten, weil die Gesellschaft ihn verstoßen hat. Darum stiftet er Chaos. Harley kehrt der Gesellschaft den Rücken, weil das Chaos aufregender ist.
Manien verlaufen episodisch (im Gegensatz zu der zeitstabilen und situationsübergreifenden dissozialen Persönlichkeitsstörung des Jokers). Auf manische Phasen mit starker Symptomatik folgen Phasen, in denen die gesunde Grundpersönlichkeit wieder hervortritt, die sich, auch bei Harley Quinn, „normale“ Dinge wünscht: Eine Familie, ein Tässchen Espresso, ein gutes Buch…
*Gharaibeh, N.M. (2005). The psychiatrist’s image in commercially available American movies. Acta psychiatrica Scandinavica, 111(4), 316-319.