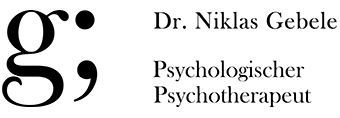Bree Van de Kamp, die im Laufe von Desperate Housewives noch weitere Nachnamen hatte, ist die klischeehafteste der an klischeehaften Vorstadthausfrauen nicht armen Wisteria Lane. Ihr Haus, ihre Familie und auch sie selbst erstrahlen stets in hellstem Glanz. Alles ist sauber und rein – zumindest an der Oberfläche.
Für diese perfekte Fassade tut Bree einiges. Ständig hat sie alle Hände voll zu tun, um alles, was weniger perfekt erscheinen könnte, unter den Teppich zu kehren. Dies gilt auch für ihr Innenleben: Aggression, Neid, Faulheit, Impulsivität, alles was unkontrolliert oder unanständig wirken könnte, hält sie tief in ihrem Inneren verborgen. Meistens macht es den Eindruck, als würde sie nicht einmal selbst diese unerwünschten Emotionen wahrnehmen. Diesen Abwehrmechanismus, bei dem eigene unerträgliche Gefühle ins Unbewusste verdrängt und dort unter Verschluss gehalten werden, nennt man Affektisolierung.
Bree hatte schon früh in ihrem Leben gute Gründe, ihre Gefühle weit von sich weg zu halten. Als Kind verlor sie ihre Mutter bei einem schrecklichen Unfall. Um das Trauma nicht passiv ertragen und all ihre Hilflosigkeit und Verzweiflung spüren zu müssen, tat sie, was sie fortan immer tun würde, sie spülte das Blut ihrer toten Mutter aus der Einfahrt, stellte Reinheit und Ordnung wieder her und ging zum Tagesgeschäft über. Später wuchs sie mit einer Stiefmutter auf, die höchste Ansprüche an Ordnung, Fleiß und Tugendhaftigkeit stellte und Bree stets wissen ließ, wenn sie an diesen scheiterte. Brees Vater, ein konfliktscheuer Ja-Sager, stand ihr vermutlich nicht bei, sondern erwartete von ihr, sich um der Harmonie willen an die überzogenen Standards seiner zweiten Frau anzupassen. So musste Bree, um in ihrer pseudo-heilen Welt überleben zu können, auch weiterhin ihre Trauer (über den Tod der Mutter), ihre Wut (auf die ungerechte Stiefmutter), ihre Enttäuschung (über den feigen Vater) und ihre Selbstzweifel hinter einer Fassade von Freundlichkeit und Perfektion verbergen.
Über die Jahre wurden die Affektisolierung und der Zwang zu äußerlicher Ordnung und Reinheit zu Brees dominierender Verhaltensstrategie und prägten ihren Charakter, so dass von möglichen anderen Erlebens- und Verhaltensweisen kaum etwas übrig blieb. Als Ergebnis dieses Prozesses, leidet Bree unter einer Zwanghaften Persönlichkeitsstörung (ICD-10: F60.5, auch anankastische Persönlichkeitsstörung genannt). Diese zeigt sich bei Bree durch die folgenden Kriterien:
- Exzessive Beschäftigung mit Details, Regeln, Ordnung, Organisation und Plänen
- Extremer Perfektionismus
- Unverhältnismäßige Leistungsbezogenheit unter Vernachlässigung zwischenmenschlicher Beziehungen
- Übertriebene Pedanterie und Befolgen sozialer Konventionen
- Rigidität und Eigensinn
- Bestehen darauf, dass andere sich exakt den eigenen Gewohnheiten unterordnen
- Abneigung dagegen, andere etwas machen zu lassen
Brees Störung wird vermutlich auch dadurch aufrecht erhalten, dass zwanghafte Züge, in gewissem Ausmaß, durchaus gesellschaftlich anerkannt und geschätzt werden. Zumal in der Wisteria Lane, wo der schöne Schein alles bedeutet. So erhält Bree von den Nachbarn viel Wertschätzung für ihr sorgsam gepflegtes Anwesen, ihr makelloses Äußeres und ihre akkuraten Kochkünste, während ihre Familie hinter verschlossenen Türen unter ihrem Zwang zur Perfektion und ihrer gefühlskalten Unnahbarkeit leidet.
Wenn dennoch zu viel in ihrem Leben zusammenkommt und die unerwünschten Gefühle immer stärker ins Bewusstsein drängen, greift Bree zum Alkohol, der zuverlässig dabei hilft, diese zu betäuben wieder in die Tiefen des Unbewussten zurückzudrängen.
Bree hat in zweifacher Hinsicht einen hohen Krankheitsgewinn: Erstens erspart ihr die konsequente Affektisolierung, die als Teil ihrer Persönlichkeitsstörung unbewusst, quasi automatisiert, abläuft, das Empfinden unangenehmer Gefühle, wie Trauer, Wut, Angst und Selbstzweifeln. Man spricht hier von primärem Krankheitsgewinn. Zweitens hat Bree, durch die gesellschaftliche Anerkennung für ihre Zwanghaftigkeit, einen über die Umwelt vermittelten, sogenannten sekundären Krankheitsgewinn.
Aufgrund dieses hohen Krankheitsgewinns sind zwanghafte Persönlichkeitsstörungen psychotherapeutisch oft schwierig zu behandeln, wie man in Brees Sitzungen mit dem Eheberater Dr. Goldfine anschaulich miterleben kann. Der subjektiv empfundene Leidensdruck liegt häufig eher beim sozialen und familiären Umfeld, welches unter der Zwanghaftigkeit und emotionalen Kälte leidet. Bree selbst ist hingegen mit ihrer Rationalität und Affektisolierung identifiziert und sieht die Notwendigkeit zur Veränderungen eher bei anderen, die in ihren Augen fehlerhaft oder gefühlsduselig sind.
Außerdem ist der psychotherapeutische Ansatz, sich den eigenen Emotionen ohne Bewertung anzunähern, für Menschen mit zwanghafter Persönlichkeitsstörung häufig wenig nachvollziehbar, da sie ihre Gefühle so konsequent abgespalten haben, dass sie tatsächlich nicht wahrnehmen, dass da noch mehr sein könnte. So wählen zwanghafte Menschen häufig nicht die therapeutische Auseinandersetzung mit den Grundlagen ihres zwanghaften Erlebens und Verhaltens, sondern suchen sich ein soziales Umfeld, das zwanghafte Eigenschaften belohnt und wenig Wert auf emotionale Einlassung legt. Das oberflächlich heile Vorstadtidyll der Wisteria Lane scheint dafür nicht schlecht geeignet zu sein.