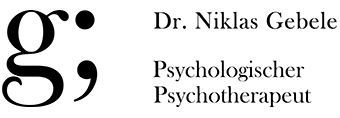The Handmaid´s Tale: Trauma und Dissoziation
- Stabilisierung: In der ersten Therapiephase wird eine vertrauensvolle Beziehung zur Therapeut*in aufgebaut und es werden Strategien im Umgang mit der akuten Symptomatik erarbeitet, die der Patient*in helfen, sich im Alltag und v.a. in akuten psychischen Krisen, selbst effektiver zu stabilisieren, z.B. Entspannungsmethoden, effektives Einfordern sozialer Unterstützung, oder andere Skills.
- Exposition: In der zweiten Therapiephase, können, sofern die Patient*in sich dazu in der Lage fühlt, die traumatischen Erlebnisse, mit allen dazugehörigen psychischen Eindrücken (Erinnerungen, Gedanken, Sinneswahrnehmungen etc.) konkret besprochen und aus der schützenden Distanz der therapeutischen Situation bearbeitet werden. Dadurch soll die Dissoziation aufgelöst und das Erlebte psychisch integriert werden. Jetzt, wo die Patient*in gelernt hat, mit den Erinnerungen und Gefühlen selbstwirksam umzugehen, und Unterstützung und Halt durch die Therapie erfährt, kann das möglich sein, wovor die Dissoziation in der Situation des Traumas noch notwendigerweise geschützt hat.
- Integration/Neuorientierung: In dieser letzten Phase der Traumatherapie geht es darum, über die konkrete Symptomatik hinaus, einen Umgang mit dem Erlebten zu finden. Was bedeutet es, der Mensch zu sein, dem diese schrecklichen Dinge widerfahren sind? Wie kann mein Leben von diesem Punkt an weitergehen? Was gibt meinem Leben auch und gerade jetzt noch Sinn? Usw.
Bates Motel & Psycho: Norman
SPOILERWARNUNG: Wer Psycho oder die zweite Staffel von Bates Motel noch nicht gesehen hat, sollte hier nicht weiterlesen. Außerdem empfiehlt es sich in diesem Fall, zuerst den Film und dann die serielle Vorgeschichte anzusehen.
Bates Motel zeigt die in unsere Gegenwart verlegte Vorgeschichte zu Alfred Hitchcocks Psycho und damit die Entwicklung des jungen Norman Bates zu einem der bekanntesten Psychokiller der Filmgeschichte.
- Zwei oder mehr unterschiedliche Persönlichkeiten innerhalb eines Individuums, von denen zu einem bestimmten Zeitpunkt jeweils eine in Erscheinung tritt
- Jede Persönlichkeit hat ihr eigenes Gedächtnis, ihre eigenen Vorlieben und Verhaltensweisen und übernimmt zu einer bestimmten Zeit, auch wiederholt, die volle Kontrolle über das Verhalten der Betroffenen
- Amnesien (Unfähigkeit, wichtige persönliche Informationen zu erinnern)
- Zusammenhang zwischen den Symptomen und belastenden Ereignissen, Problemen oder Bedürfnissen
In einer gesünderen psychischen Entwicklung hätte Norman sich von seiner Mutter zunächst stärker ablösen und dafür in Kauf nehmen müssen, dass diese sich davon auch einmal gekränkt und verletzt fühlt. Hierzu hätte allerdings Norma ihre eigenen Kränkungen und Ängste besser selbst bewältigen können müssen, um ihrem Sohn nicht das Gefühl zu vermitteln, allein für ihr Wohl und Wehe verantwortlich zu sein. Wäre die pubertäre Ablösung gelungen, hätte Norman ohne Schuldgefühle eine eigene Identität entwickeln können und wäre dennoch frei gewesen, einige Überzeugungen und Werte seiner Mutter als seine eigenen zu übernehmen. Die Beziehung zu ihre wäre zwar weniger eng, dafür aber freier von Schuldgefühlen und Vereinnahmungsängsten und damit für Norman weniger konflikthaft geworden.
Fight Club & Zwielicht
Beide Filme behandeln, jeweils anhand der von Edward Norton dargestellten Charaktere, das Thema gespaltene Persönlichkeit, oder, im psychologischen Fachjargon Multiple Persönlichkeitsstörung, welche nach IDC-10 (F44.81) wie folgt beschrieben wird:
- Zwei oder mehr unterschiedliche Persönlichkeiten innerhalb eines Individuums, von denen zu einem bestimmten Zeitpunkt jeweils eine in Erscheinung tritt
- Jede Persönlichkeit hat ihr eigenes Gedächtnis, ihre eigenen Vorlieben und Verhaltensweisen und übernimmt zu einer bestimmten Zeit, auch wiederholt, die volle Kontrolle über das Verhalten der Betroffenen
- Unfähigkeit, wichtige persönliche Informationen zu erinnern (zu ausgeprägt für eine einfache Vergesslichkeit)
- Nicht bedingt durch eine hirnorganische Störung oder durch psychotrope Substanzen
- Überzeugender zeitlicher Zusammenhang zwischen den Symptomen und belastenden Ereignissen, Problemen oder Bedürfnissen
In Fight Club spielt Edward Norton den namenlosen Protagonisten, der in der Rezeption häufig Jack genannt wird (im Bezug auf die Zeitschriftenartikel aus der Perspektive der inneren Organe einer Person namens Jack), und der wahrscheinlich die prämorbide Grundpersönlichkeit darstellt. Auf andauernde Gefühle von Sinnlosigkeit und Einsamkeit reagiert Jack zunächst mit heftigen Schlafstörungen (ICD-10: F51.0, Nichtorganische Insomnie), die ihn noch weiter an die psychische und physische Belastungsgrenze bringen. Die letzte Rettung für seine dem Zusammenbruch nahe Psyche ist die Dissoziation eines Persönlichkeitsanteils, den Jack bisher nicht ausleben konnte, wahrscheinlich aufgrund von Angst, Scham und einer Erziehung und Sozialisation, die Anpassung, Unterordnung und den Rückzug in eine materiell-private pseudoheile Welt propagiert haben. Dieser Persönlichkeitsanteil, gespielt von Brad Pitt, heißt Tyler Durden und verkörpert nach eigener Aussage „all das was du immer sein wolltest…„, was in erster Linie Autonomie, Impulsivität, aggressive und sexuelle Exzessivität und grenzenloses Selbstvertrauen bedeutet. Jack leidet, wie er in einer Szene berichtet, darunter, seinen Vater kaum gekannt zu haben und nur von Frauen erzogen worden zu sein. Mit Tyler lebt er sein idealisiertes männlich-kraftvolles Persönlichkeitsideal aus. Die Abspaltung dieses Persönlichkeitsanteils ist zunächst noch notwendig, weil Jack zu tief in seinen Ängsten und Unsicherheiten gefangen ist, um bewusst Veränderungsschritte einleiten zu können.
Ein ähnlicher Zusammenhang besteht im Film Zwielicht zwischen den beiden Persönlichkeitsanteilen Aaron und Roy (diesmal beide gespielt von Edward Norton), wenngleich sich zum Schluss herausstellt, dass, anders als es zunächst den Anschein hatte (und auch anders als in Fight Club), nicht der unsichere, ängstliche Aaron die prämorbide Grundpersönlichkeit verkörpert, sondern dass dieser eine bloße Erfindung des aggressiven und manipulativen Roy, der in Wahrheit doch nicht unter einer multiplen Persönlichkeitsstörung leidet, ist.
Zudem besteht ein Unterschied zwischen den beiden Filmen darin, dass Aaron und Roy nie gleichzeitig auftreten, was, wenngleich sich Roy als Simulant entpuppt, die realistischere Darstellung der multiplen Persönlichkeitsstörung ist, während die ausführlichen Dialoge zwischen Jack und Tyler eher an visuelle und akustische Halluzinationen erinnern, wie sie beispielsweise im Rahmen einer Paranoiden Schizophrenie (ICD-10: F20.0) typisch sind und weniger bei multipler Persönlichkeitsstörung.
Ein anderes Störungsbild, welchem in beiden Filmen eine zentrale Rolle zukommt, ist die Dissoziale Persönlichkeitsstörung. Diese ist nach ICD-10 (F60.2) gekennzeichnet durch:
- Herzloses Unbeteiligtsein gegenüber den Gefühlen anderer
- Deutliche und andauernde verantwortungslose Haltung und Missachtung sozialer Normen, Regeln und Verpflichtungen
- Unfähigkeit zur Aufrechterhaltung dauerhafter Beziehungen, obwohl keine Schwierigkeit besteht, sie einzugehen
- Sehr geringe Frustrationstoleranz und niedrige Schwelle für aggressives, einschließlich gewalttätiges Verhalten
- Fehlendes Schuldbewusstsein oder Unfähigkeit, aus negativer Erfahrung, insbesondere Bestrafung, zu lernen
- Deutliche Neigung, andere zu beschuldigen oder plausible Rationalisierungen anzubieten für das Verhalten, durch welches die Betreffenden in Konflikt mit der Gesellschaft geraten sind
Dies führt zu einer weiteren Gemeinsamkeit beider Filme: Die Darstellung (vermeintlich) dissoziativ gestörter Hauptcharaktere hat auch die Funktion des Hinweises auf dissoziative Elemente im gesamtgesellschaftlichen Geschehen.
In Zwielicht wird der simulierten Persönlichkeitsspaltung des wegen Mordes angeklagten Aaron/Roy die ihrerseits an Persönlichkeitsspaltung grenzende Bigotterie der herrschenden Klasse gegenübergestellt und die durchweg selbstsüchtigen, macht-, ruhm-, geldgierigen und perversen Motive der nach außen hin makellos anständigen Würdenträger aus Gesellschaft, Justiz und Kirche werden vorgeführt.
Fight Club thematisiert ausführlich die dissoziative Gefühlsabspaltung als Massenphänomen in einer Gesellschaft, die durch permanenten materiellen und medialen Passivkonsum und das axiomatische Gebot von Konformität und Selbstoptimierung in einem hypnotischen Zustand geduldeter Unterwerfung und Gefügigkeit gehalten werden soll, welcher wiederum (und hier schließt sich der Kreis) im eigensten Interesse der, in Zwielicht charakterisierten, herrschenden Minderheit sein soll.
Summa Summarum ist Roy ein kaltblütiger Mörder und Tyler ein Extremist und Terrorist. Einen Anstoß, dissoziative Phänomene im eigenen Alltagserleben wahrzunehmen und die Maximen der eigenen Lebensführung einer Überprüfung zu unterziehen, können uns die Filme dennoch liefern.
Rambo I-IV: John Rambo
John J. Rambo ist ein hochdekorierter Veteran des Vietnamkriegs, jenem Krieg, in dessen Folge durch die psychologische Erforschung der Traumafolgeerkrankungen der heute gültige Begriff Posttraumatische Belastungsstörung (PTBS, englisch: Posttraumatic Stress Disorder PTSD) eingeführt wurde.
Wie viele seiner Kameraden (und Generationen von Soldaten davor und danach) leidet auch Rambo nach seiner Heimkehr unter dieser Störung, die nach ICD-10 (F43.1) durch die folgenden Kriterien definiert wird:
- Der Betroffene war (kurz oder lang anhaltend) einem belastendem Ereignis von außergewöhnlicher Bedrohung oder mit katastrophalem Ausmaß ausgesetzt, das bei fast jedem eine tiefe Verzweiflung hervorrufen würde
- Es müssen anhaltende Erinnerungen an das traumatische Erlebnis, oder das wiederholte Erleben des Traumas in sich aufdrängenden Erinnerungen (z. B. Flashbacks), oder eine innere Bedrängnis in Situationen, die der Belastung ähneln oder damit in Zusammenhang stehen, vorhanden sein
- Der Betroffene vermeidet (tatsächlich oder möglichst) Umstände, die der Belastung ähneln
- Sowie entweder: Eine teilweise oder vollständige Unfähigkeit, sich an einige wichtige Aspekte des belastenden Erlebnisses zu erinnern, und/oder:
- Anhaltende Symptome einer erhöhten psychischen Sensitivität und Erregung, z. B. erhöhte Schreckhaftigkeit, Hypervigilanz, Reizbarkeit und Wutausbrüche
Folglich empfindet Rambo den typischen, übermächtigen Drang, die retraumatisierende Situation zu verlassen, was er genreentsprechend impulsiv umsetzt, indem er sich seinen Weg aus der Arrestzelle freikämpft, womit auch die Frage nach Reizbarkeit und Wutausbrüchen bereits beantwortet wäre.
Ob Rambo sich an Teile des erlebten nicht mehr erinnern kann, wissen wir nicht. Zumindest scheint er die dazugehörigen Emotionen zunächst gut verdrängt zu haben, bis sie durch die erneute Gewalterfahrung wieder aktiviert werden.
Deutlich können wir jedenfalls Hypervigilanz (d. h. gesteigerte Wachsamkeit) und erhöhte Schreckhaftigkeit beobachten, wenn Rambo, einem Wildtier gleich, in sekundenschnelle das Bedrohungspotential einer Situation erfasst und instinktiv blitzschnell mit Kampf- oder Fluchtbewegungen reagiert.
Rambo ist also schwer traumatisiert. Umso mehr muss man sich fragen, warum er sich immer wieder selbst in Situationen bringt, die ihn mit Gewalt, Krieg und Tod konfrontieren und damit sein Trauma reaktualisieren, was auch als Wiederholungszwang bezeichnet wird.
Bereits auf die erste (noch recht harmlose) Feindseligkeit des Sheriffs reagiert er passiv-aggressiv indem er sich ihm provokativ widersetzt. In den drei Fortsetzungen lässt er sich zwar jeweils nicht sofort zum kämpfen überreden, findet dann aber doch immer recht schnell Gründe, um wieder in den Krieg zu ziehen.
Um Rambos Verhalten zu verstehen, müssen zunächst die psychischen Mechanismen der Traumabewältigung erörtert werden:
Rambo erlebt in der Kriegsgefangenschaft Dinge, die psychisch kaum zu verarbeiten sind. Wahrscheinlich werden die schier unaushaltbaren Gefühle von Todesangst, Schmerz, Verzweiflung und auch Hass schon während der Traumatisierung abgespalten. Das bedeutet, sie werden so erlebt, als gehörten sie gar nicht zu dem jungen John J. Rambo aus Bowie, Arizona, der sie auch kaum überleben könnte. Im unbewussten Teil der Psyche entsteht eine abgespaltene zweite Entität, die auf sich nimmt, was das Ich nicht tragen kann. Diesen Vorgang nennt man Dissoziation.
Colonel Trautman bringt es, leider recht unkritisch, auf den Punkt: Rambo sei „ein Mann, der darauf trainiert ist, keine Schmerzen zu fühlen, der sie verdrängt… In Vietnam konnten Rambo und ich uns Emotionen nicht leisten.“
Dabei scheint er Schuldgefühle angesichts seiner eigenen Verantwortung für Rambos wiederholte Traumatisierung narzisstisch abzuwehren: „Gott hat Rambo nicht geschaffen, ich habe ihn geschaffen.“
Doch zurück zu Rambo: Die dissoziierten Anteile sind, wie gesagt, zunächst einmal unbewusst. Dadurch kann das Ich im Allgemeinen weiter funktionieren, ohne permanent durch das Trauma und die dazugehörigen Affekte gestört zu werden. Das funktioniert aber nur solange, wie die unbewussten Inhalte nicht durch Auslösereize (bei Rambo zum Beispiel Rasiermesser, Gitterstäbe, Schusswaffen) ins Bewusstsein gerufen (getriggert) werden, was sich dann beispielsweise in Form von Flashbacks zeigt. Dann nämlich fühlt sich Rambo unmittelbar in die traumatische Situation zurückversetzt und mit den existenziellen Ängsten konfrontiert.
Damit das Ich vor diesen überwältigenden Affekten nicht kapitulieren muss, kommt nun ein weiterer Abwehrmechanismus zum Tragen, der bei Rambo besonders stark ausgeprägt ist: Die Identifikation mit dem Aggressor.
Statt sich Krieg und Folter hilflos ausgeliefert zu fühlen, wie es real der Fall gewesen ist, identifiziert sich Rambo mit den Kriegern und Folterern, ja mit dem Krieg selbst. Im vierten Teil der Reihe kann er dies bereits benennen: „Du hast erkannt, wer du bist, woraus du gemacht bist. Krieg hast du im Blut. Wenn man dich dazu zwingt, ist Töten so einfach wie Atmen“ (Wobei letzteres, im Falle starker Angst, so leicht gar nicht ist). Die Macht seiner Gegner macht sich Rambo identifikatorisch zu eigen, seine Todesangst projiziert er auf die Feinde zurück. Da er in der Tat ein überaus begabter Kämpfer ist, gelingt es ihm auch immer wieder, die innerpsychischen Abwehrmechanismen handelnd in der Realität umzusetzen. Somit wird das Selbstbild der Kriegsmaschine durch die Zuschreibungen der Anderen, die ihn real fürchten müssen, oder ihn, wie Trautman, nur um seiner Kampfkraft willen respektieren, verfestigt.
Folglich ist der Krieg Rambos Weg, nicht an seinen eigenen Ängsten zugrunde zu gehen. Und es sind sehr menschliche Ängste, z. B. vor Ausgrenzung und Einsamkeit (Teil 1), vor dem Verlust von Freiheit (Teil 2), vor dem Tod eines engen Freundes (Teil 3) oder einer heimlich geliebten Frau (Teil 4), die ihn immer wieder zur Kriegsmaschine werden lassen.