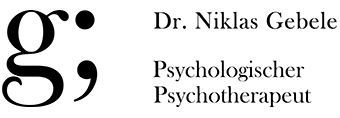Systemsprenger ist ein großartiger, schmerzhafter, weitgehend realistischer Film über ein Kind mit einer schweren Bindungsstörung und die Lücken in unserem sozialpädagogisch-psychiatrischen Versorgungssystem. Allerdings ist der Film potentiell auch sehr triggernd, durch die Darstellung von Traumatisierung, emotionaler Vernachlässigung und Gewalt. Insofern ist der Film dringend allen zu empfehlen, die sich so etwas ansehen können – allen anderen ist dringend davon abzuraten. Nachdem das gesagt ist, hier mein – weitgehend spoilerfreier – erster Eindruck.
 |
| Quelle: https://www.systemsprenger-film.de/ |
Was also macht den Film so gut? Zunächst mal sind die Schauspieler*innen, allen voran die Hauptdarstellerin Helena Zengel (Benni), durch die Bank großartig und jedes Setting so realistisch, dass man als Profi aus dem Bereich Kinder- und Jugendhilfe/-psychiatrie ständig ein „Ja, genau so…“-Gefühl hat und als Laie einen ziemlich realitätsnahen Eindruck vermittelt bekommt, wenngleich dieser im Spielfilm (anders als in einer Dokumentation) natürlich unkommentiert bleibt, was manche Vorgehensweisen des Personals der verschiedenen Einrichtungen vielleicht schwer einzuordnen und nachzuvollziehen macht, z. B. die wiederholten Fixierungen, den Off-label-use von Neuroleptika oder die genauen Erwägungen, warum Benni bestimmte Einrichtungen verlassen muss. Andererseits versetzt genau diese Intransparenz die Zuschauenden auch in die Perspektive der Protagonistin Benni, der all diese Maßnahmen ebenfalls willkürlich und zum Teil grausam erscheinen müssen.
Der Film zeigt hier die ganze Überforderung, Desillusionierung und Frustration eines Hilfesystems, in dem durchaus engagierte und liebevolle Menschen, teilweise bis zur persönlichen Verausgabung, aktiv sind. Die Grenzen des Systems liegen nicht in Engagement oder Qualifikation der Fachkräfte, sondern im maximal banalen Fehlen von Ressourcen, i.e. Zeit und Geld. Um es klar zu sagen: Das deutsche Kinder- und Jugendhilfesystem und die Versorgungsstrukturen der Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie sind unterm Strich nicht so schlecht und bieten einer sehr großen Zahl Kinder und Jugendlicher mit ihren Familien hochwertige professionelle Unterstützung und Behandlung. Das frustrierende und eigentlich unfassbare ist nicht, dass Systeme an ihre Grenzen geraten, sondern, dass unser System eben vor allem an finanzielle und damit vermeidbare Grenzen stößt. Mehr Geld, mehr Zeit, mehr Personal – das wäre nicht unmöglich; folglich sind wir alle, als Bürger, Wähler und Mitmenschen, dafür verantwortlich, wenn und wo es nicht funktioniert. Damit ist der Film auch ein Appell an die Zuschauenden, die Themen Kinder- und Jugendhilfe, psychische Gesundheit und psychosoziale Versorgung aller, speziell der sozioökonomisch schwächeren Gesellschaftsschichten, nicht erst und nur dann wichtig zu finden, wenn spektakuläre Fehler und Unterlassungen durch die Presse gehen.
Genau hier wird dieser kleine deutsche Film zum psychologischen Meisterwerk: Er zwingt – und es ist oft ein schmerzhafter Zwang – uns nicht nur hinzusehen, sondern auch intensiv zu fühlen. Bereits nach wenigen Minuten und bis über den Abspann hinaus, spürt man die intensive, schier unerträgliche Daueranspannung, die Kinder wie Benni ständig begleitet.
Aufgrund der frühen Traumatisierung, der immer und immer wieder enttäuschten Beziehungswünsche und aggressiven Gegenreaktionen ihres Umfelds, ist für Benni keine Situation, nicht einmal die oberflächlich glücklichen Momente, sicher. Indem der Film uns brachial in diese Gefühlswelt hineinzieht erleben wir, wie Benni, unterschwellig gerade in diesen Situationen – Pommes essen, Schlittschuh laufen, mit einem Baby spielen – sogar die größte Anspannung, weil uns der Film früh klarmacht, dass in Bennis Welt jederzeit jede Kleinigkeit zur absoluten Eskalation führen kann. Kurze Verschnaufpausen bieten, paradoxerweise, nur die Szenen, in denen Benni sediert und fixiert im Überwachungsraum der Kinder- und Jugendpsychiatrie liegt: Der traurige Höhepunkt jeder Eskalation und der einzige kurze Moment des Innehaltens vor dem nächsten Sturm.
Psychopathologisch gesehen, hat Benni eine Bindungsstörung des Kindesalters mit Enthemmung (ICD-10 F94.2), die durch folgende Symptome definiert ist:
- Beziehungsmuster mit einer Mischung aus Annäherung und Vermeidung sowie Widerstand gegen Zuspruch
- Eingeschränkte Interaktion mit Gleichaltrigen
- Beeinträchtigung des sozialen Spielens
- Gegen sich selbst und andere gerichtete Aggressionen
- Nicht-selektives Bindungsverhalten mit wahlloser Freundlichkeit und Distanzlosigkeit
- Gleichförmige Interaktionsmuster gegenüber Fremden
- Inadäquate Reaktionen auf Beziehungsangebote von Bezugspersonen
Mögliche Ursachen dieser Bindungsstörung sind Misshandlung, Missbrauch und Vernachlässigung, v.a. in den ersten Lebensjahren, sowie inkonsistente und wechselnde Bezugspersonen. Die Kinder entwickeln dadurch keine sichere Bindung bzw. das, was gerne Urvertrauen genannt wird. Keine soziale Situation fühlt sich sicher, keine andere Person wirklich verlässlich an. Wer sich nie sicher fühlt, muss psychologisch und physiologisch ständig reaktionsbereit sein, d.h. das sympathische Nervensystem, zuständig für die sogenannte Fight-or-flight-Reaktion ist ständig aktiviert: Mehr Stresshormone werden ausgeschüttet, man ist schreckhaft, reizbar, angespannt und überdreht.
Die Daueranspannung ist so anstrengend und unaushaltbar, dass den Kindern letztlich eine Wahl bleibt, als die nächste Eskalation herbeizuführen, um danach für einen kurzen Moment Ruhe zu haben – und sei es durch Gewalt, Zwang, Verlassenwerden oder absolute Erschöpfung.
Trotz allem sind auch diese schweren Bindungsstörungen behandelbar. Was es dazu braucht, wird im Film angedeutet: Intensive pädagogische Betreuung durch langfristig konstante Bezugspersonen, die wiederum ausreichend Zeit, Ressourcen und Supervision erhalten, um den langen und von Rückschlägen geprägten Weg zu gehen. Und eine Kinder- und Jugendpsychiatrie, für die dasselbe gilt. Leider sind das Dinge, die wir uns als Gesellschaft bisher nicht leisten wollen. Und so lässt uns der Film am Ende ratlos und traurig zurück – ebenso wie schon viele der realen Bennis uns als Profis am Ende ratlos und traurig zurückgelassen haben.