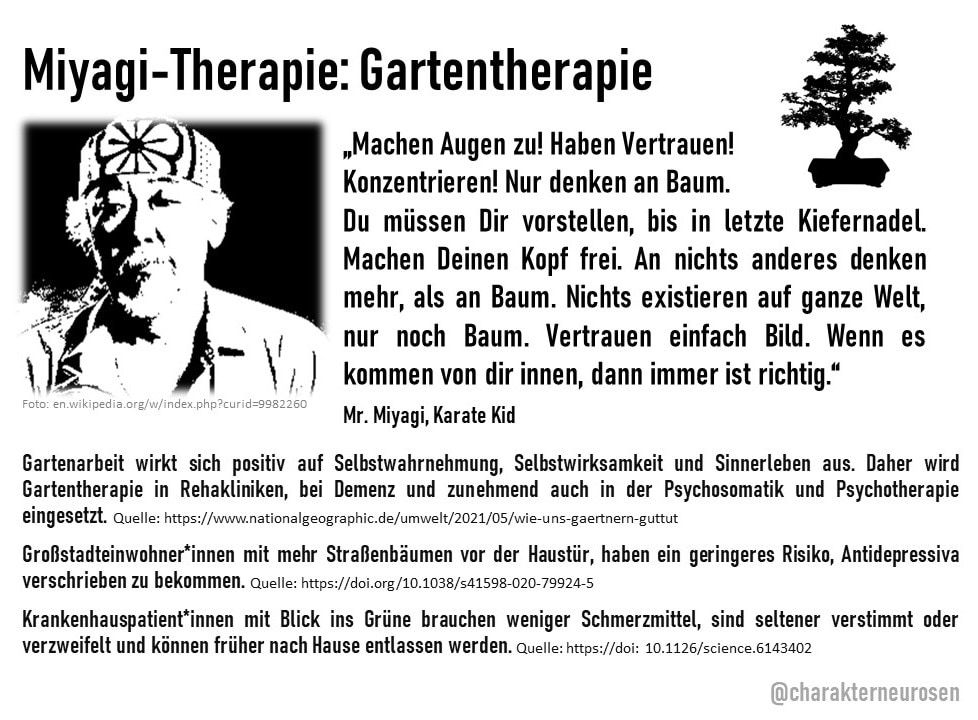
Miyagi-Therapie: Gartentherapie
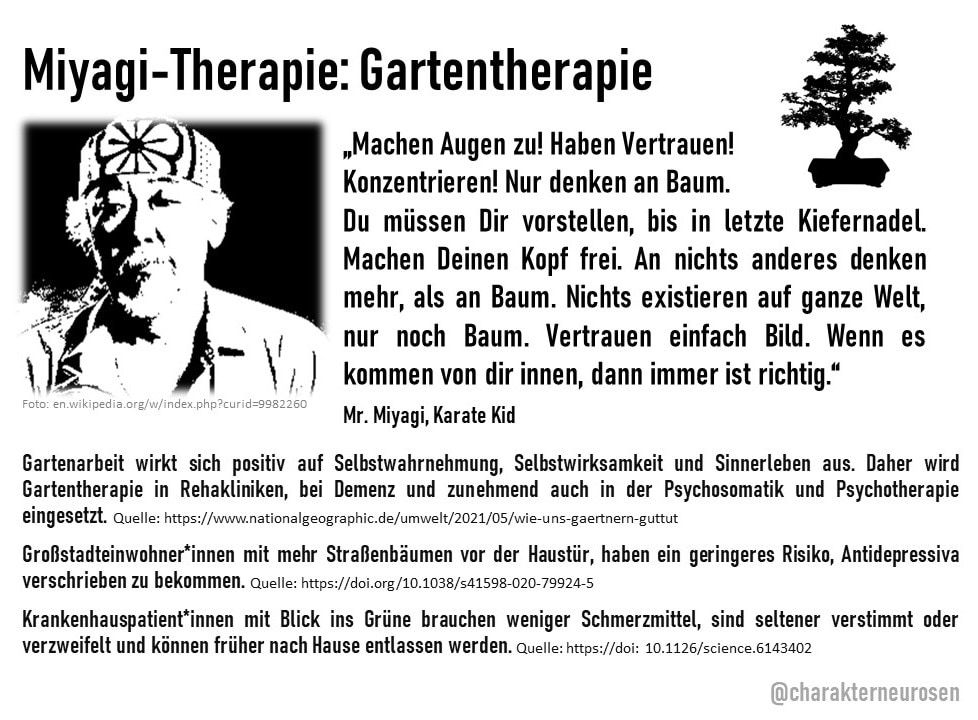
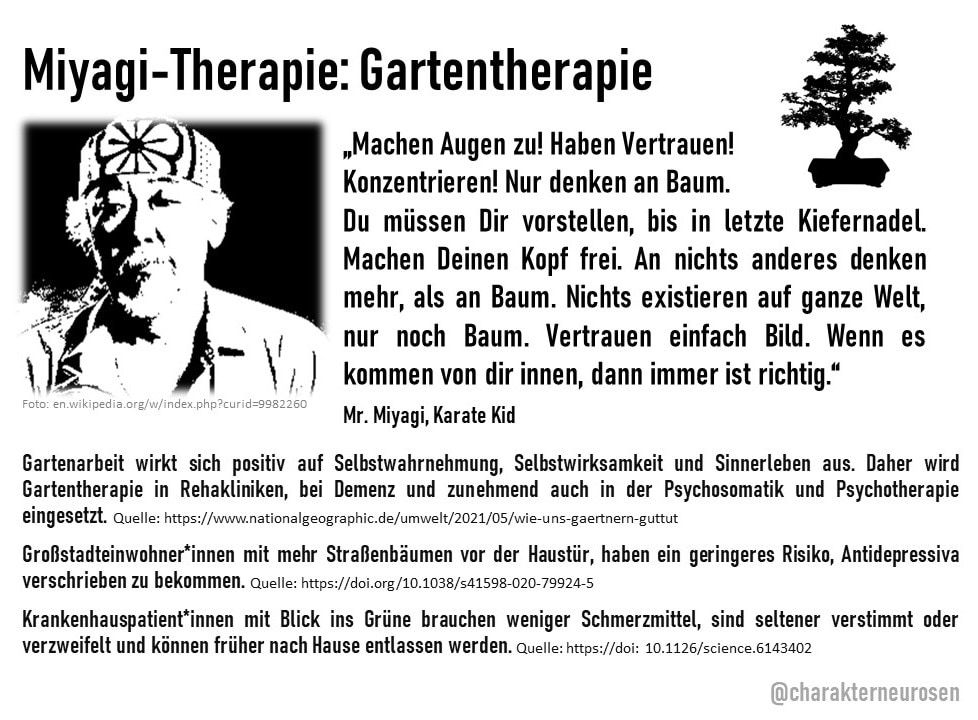
„Bist du nicht müde
Nach so vielen Jahren?
Weißt deine Fragen nicht mehr
Kriegst keinen klaren Satz zusammen
Redest wirres Zeug
Erstickst an den Worten
Setzt deine Träume aus
An trostlosen Orten…
Gib mir das, ich kann es halten
Gib mir das, ich kann es halten.“
Wir sind Helden: Bist Du nicht müde
Das psychotherapeutische Konzept des Holding (Halten, Halt-Geben) geht auf den englischen Kinderpsychiater Donald W. Winnicott zurück, der es aus der Beobachtung von Müttern entwickelte, die ihre kleinen Kinder beruhigen, indem sie sich ihnen aufmerksam zuwenden, sie halten, auf den Arm nehmen und ruhig und melodisch mit ihnen sprechen.
In ähnlicher Weise können Therapeut*innen ihren Patient*innen dabei helfen, starke unangenehme Gefühle auszuhalten und zu bewältigen, indem sie sich ihnen mit einer Haltung von Ruhe, Akzeptanz, Interesse und Nicht-Bewertung zuwenden und diese auch bei starken Gefühlen und schwierigem Verhalten konsequent und verlässlich aufrecht erhalten. So entsteht zunächst die Erfahrung, dass selbst diese Gefühle grundsätzlich aushaltbar und bewältigbar sind und letztlich, dass auch ich dazu in der Lage bin.

In der Animeserie Demon Slayer wenden die Protagonist*innen verschiedene Atemtechniken an, um ihre Konzentration und Kampfkraft zu steigern.
Auch in der Psychotherapie kann die Atmung als hilfreicher „Anker“ eingesetzt werden. Viele dysfunkionale Erlebens- und Verhaltensweisen, welche im Leben zu Problemen und Leidensdruck führen, bestehen vor allem deshalb dort, weil sie unbewusst, quasi automatisch als Reaktion auf bestimmte Auslöser (gerne auch „Trigger“ genannt) erfolgen. Wären wir uns immer unserer Handlungsimpulse, deren Konsequenzen und Alternativen voll bewusst, würde allein das die Wahrscheinlichkeit des Problemverhaltens deutlich reduzieren. Die Psychologin Tara Brach fasst eine einfache und doch sehr wirksame Technik zur Selbstregulation in das griffige Akronym R-A-I-N :
Ich habe R-A-I-N für meine deutschsprachigen Psychotherapien in R-A-U-M (für Veränderung) übersetzt:

Diese vier kurzen Schritte können schon sehr helfen, in angespannten, ängstigenden, überfordernden Situationen nicht in einer zu destruktiven Weise z.B. mit Aggression, Vorwürfen, Rückzug, Vermeidung, Scham oder Schuldgefühlen zu reagieren, sondern etwas bewusster und dadurch vielleicht abgewogener, moderater, konstruktiver zu handeln.
Hierbei kann eben die Atmung ein hilfreicher Anker sein: Wenn ich realisiere, dass ich gerade sehr angespannt bin, kann ich, kann ich mir bereits mit nur einem tiefen Atemzug Die Zeit verschaffen, um zu untersuchen, was gerade los ist und daraus Schlüsse für ein angemessenes, konstruktives Handeln zu ziehen. Dieses Handeln kann auch erstmal nach Innen gerichtet sein, z.B. durch ein paar weitere tiefe, bewusste Atemzüge für noch mehr Beruhigung und Fokus zu sorgen.
Tara Brach entlehnt ihre R-A-I-N-Technik der Achtsamkeitslehre des in Asien entstandenen Zen- Buddhismus. Insofern ist es nicht überraschend, dass in einem Anime wie Demon Slayer auch die Dämonenjäger*innen auf Techniken der achtsamen Atmung zurückgreifen um sich in Situationen größter Bedrohung und Anspannung zu fokussieren. Besonders eine Variante des Water Breathing, die sich Dead Calm nennt, weißt hier große Ähnlichkeit zu real eingesetzten Atemtechniken auf: Bei dieser Technik wird der Körper ganz still gehalten, volle Konzentration angestrebt und dadurch maximaler Fokus auf den zu bewältigenden Angriff ermöglicht. Das Wasser als Symbol passt hier sehr gut, denn so sanft und flexibel es ist, bezieht es gerade dadurch seine Widerstandskraft und Beharrlichkeit („steter Tropfen höhlt den Stein“).
In den buddhistisch orientierten Achtsamkeitsmethoden wird das Wasser daher ebenfalls gerne als Metapher verwendet: Ein aktuell sehr intensives Gefühl kann wie eine Welle sein, die uns mitreißen, runterziehen und uns vermeintlich die Luft zum Atmen nehmen kann. Letztlich jedoch geht jede, auch noch so mächtige Welle wieder ins Meer über, welches still und ewig die Gezeiten überdauert. Ebenso können wir lernen, heftige Gefühle auszuhalten, ohne uns vollständig mitreißen zu lassen, in dem Wissen, dass sie wieder abflauen werden und wir dann wieder zur Gelassenheit zurückfinden können („be the ocean, not the wave“). Und was hilft, um von einer starken Welle nicht zu weit mitgerissen zu werden? – Genau: Ein Anker.
Wenn also das nächste Mal alles zu viel wird, wir uns angegriffen, überfordert und verzweifelt fühlen und vielleicht in der Gefahr sind, ernsthaft destruktiv zu reagieren: Atmen!
Oder, für die Anime-Fans: Total Concentration! Water Breathing!


TRIGGERWARNUNG: Selbstverletzendes Verhalten
I hurt myself today, to see if I still feel
Selbstverletztendes Verhalten – wie es in Hurt (1994 von Trent Reznor/Nine Inch Nails, 2002 fulminant gecovert von Johnny Cash) beschrieben wird – ist meist ein Symptom psychischer Erkrankungen oder zumindest emotionaler Probleme. Im Gegensatz zu gängigen Klischees ist es meist kein bewusster Ruf nach Aufmerksamkeit, eher ein unbewusster Ausdruck von Überforderung und Hilflosigkeit. Auch ist selbstverletzendes Verhalten nicht automatisch ein Hinweis auf Suizidalität oder gar immer ein Suizidversuch. Häufig stellt das daher so genannte nicht-suizidale selbstverletzende Verhalten (NSSV) einen Versuch da, sehr starke Gefühle zu regulieren, z.B.
Selbsthass – What have I become my sweetest friend
Einsamkeit – Everyone I know goes away in the end
Schmerz – I wear this crown of thorns upon my liar’s chair
Verzweiflung – Full of broken thoughts I cannot repair
Diese Gefühle können, wenn sie eine unerträgliche Intensität erreichen und die betroffene Person keine anderen Wege zur deren Regulation findet, zu einer extremen und diffusen inneren Anspannung führen, die das Gefühl, ein stabiles Ich zu sein, handlungsfähig in einer im Prinzip verstehbaren Welt zu sein, derart beeinträchtigen, dass der konkrete körperliche Schmerz wie ein Anker zur Realität, zur eigenen Handlungsfähigkeit, sein kann, der kurzfristig Beruhigung und Sicherheit zurückbringt.
I focus on the pain, the only thing that’s real
Dieses Gefühl beschreibt auch Gillian Flynn in dem großartigen (aber auch sehr triggernden!) Roman Cry Baby – Scharfe Schnitte (original Sharp Objects, sehr gelungen verfilmt als HBO-Miniserie und hier im Blog schon besprochen):
Mein Körper loderte förmlich. Ich lief umher, konzentrierte mich aufs Atmen, wollte meine Haut beruhigen. Doch sie schrie es laut heraus. Manchmal haben Narben ihren eigenen Willen… Als ich an jenem heißen, öden Morgen aufwachte, dachte ich mit Grauen an die Stunden, die vor mir lagen. Wie kann man sich sicher fühlen, wenn der ganze Tag so weit und leer ist wie der Himmel?
Ein Mensch, der sich selbst verletzt, ist nicht schwach, verrückt oder versucht, sich grundlos wichtig zu machen. Ein Mensch, der sich selbst verletzt, sucht nach Auswegen aus tiefer Verzweiflung und unerträglichem seelischem Schmerz. Ein Mensch, der sich selbst verletzt, hat noch nicht vollständig aufgegeben:
I am still right here
Ein Mensch der sich selbst verletzt, sollte unbedingt ernst genommen, nicht verurteilt oder abgewertet werden und bestenfalls kompetente professionelle Hilfe erhalten!
I’m tired of being what you want me to be
Feeling so faithless, lost under the surface
Don’t know what you’re expecting of me
Put under the pressure of walking in your shoes
Every step that I take is another mistake to you
Als inneren Kritiker oder inneren Verfolger bezeichnet man in der Psychotherapie negative Gedanken über sich selbst. Die lautlose innere Stimme, die uns beständig kritisiert, verurteilt, entwertet und beschämt:
Can’t you see that you’re smothering me
Holding too tightly, afraid to lose control?
Es ist wichtig zu verstehen, dass innere Kritiker auf den Glaubenssätzen der Personen beruhen, die unsere frühe Persönlichkeitsentwicklung prägen: Eltern, Großeltern, Geschwister, Gesellschaft: „Das und das gehört sich nicht“, „Sei nicht so und so“ etc. Diese Glaubenssätze sind Ausformulierungen von deren persönlichen Ängsten, Unsicherheiten, Scham- und Schuldgefühlen. Und diese beruhen wiederum auf denen der vorherigen Generation:
But I know
You were just like me with someone disappointed in you
Wir dürfen diese negativen Glaubenssätze unseren Altvorderen zurückgeben. Differenzierte Selbstkritik ist wichtig, aber der Maßstab dafür dürfen unsere eigenen Überzeugungen und Werte sein:
All I want to do
Is be more like me
And be less like you
 Beziehungsprobleme – Commitment Issues – sind nicht nur ein beliebter Topos für Songs oder Filme, sondern auch Kernthema vieler Psychotherapieprozesse.
Beziehungsprobleme – Commitment Issues – sind nicht nur ein beliebter Topos für Songs oder Filme, sondern auch Kernthema vieler Psychotherapieprozesse.
Der Philosoph Arthur Schopenhauer verglich einst das menschliche Beziehungsverhalten mit einer Gruppe Stachelschweine im Winter: Alleine stehend friert jedes Tier und sucht folglich die Nähe der anderen. Rücken die Stachelschweine jedoch zu nahe zusammen, verletzten sie sich an den Stacheln der anderen, woraufhin sie wieder weiter auseinanderrücken. Da es den Punkt perfekter Distanz auf Dauer nicht gibt, entsteht eine ständige Hin- und Weg-Bewegung mit dem Ziel einer hinreichenden, möglichst ausgewogenen, Nähe-Distanz-Regulation.
Auf uns Menschen übertragen, suchen wir als soziale Wesen Verbundenheit, Sicherheit, Rückhalt, Bestätigung und soziale Anregung durch andere. Gleichermaßen binden uns die sozialen Bezüge, begrenzen somit unsere freie persönliche Entfaltung und nötigen uns Kompromisse im Handeln, aber auch im Denken und Fühlen, ab.
Beide Motive, Bindung und Autonomie, müssen wir ständig in einer unseren individuellen Bedürfnissen entsprechenden Balance halten, bzw. diese immer wieder aufs Neue herstellen. Das Stichwort für eine gelingende Lösung heißt bezogene Individuation – die Selbstverwirklichung betreiben und dabei trotzdem, grundsätzlich, in Beziehung bleiben.

Der Rapper Sido und der legendäre britische Kinder-Psychoanalytiker Donald W. Winnicott sind sich einig: Dissoziales (Norm-verletzendes Verhalten) bei Kindern und Jugendlichen ist nicht als etwas störendes und durch Druck zu unterbindendes zu verstehen, sondern als ein Hinweis, ein Hilferuf an Autoritäten und Bezugspersonen.
Es gilt die alte kinder- und jugendpsychotherapeutische Weisheit: Bevor ein Kind Probleme macht, hat es welche!
Foto: ZDF/Julia Vietinghoff
Es ist ein Geschenk, dass mich fast jeden Wochentag mit Freude und Dankbarkeit erfüllt, meinen Lebensunterhalt mit etwas verdienen zu können, was derart erfüllend, sinnvoll, interessant, abwechslungsreich und spannend ist, wie Psychotherapie. Ich fühle mich da oft, wie Ernest Lash, der Protagonist aus Irvin D. Yaloms großem Psychotherapieroman Lying on the Couch (Die rote Couch):
„Ernest liebte es, Psychotherapeut zu sein. Tag für Tag ließen ihn seine Patienten in den verborgensten Winkeln ihres Lebens stöbern, Tag für Tag tröstete er sie, teilte ihre Sorgen und linderte ihre Verzweiflung. Wofür er seinerseits bewundert und gehätschelt wurde. Und auch bezahlt, obwohl er auch ohne Honorar als Therapeut gearbeitet hätte, wenn er auf das Geld nicht angewiesen gewesen wäre.
Glücklich der, der seine Arbeit liebt. Und Ernest schätzte sich tatsächlich glücklich. Mehr als glücklich. Gesegnet. Er war ein Mann, der seine Berufung gefunden hatte – ein Mann, der sagen konnte, ich bin genau da, wo ich hingehöre, im Auge des Sturms, wo meine Talente, meine Interessen, meine Passionen gebündelt sind.
Ernest war kein religiöser Mensch. Aber wenn er morgens seinen Terminkalender aufschlug und die Namen der acht oder neun Lieben sah, mit denen er den Tag verbringen würde, wurde er von einem Gefühl überwältigt, das er nur als religiös bezeichnen konnte. In diesen Momenten verspürte er ein tiefes Gefühl der Dankbarkeit allem gegenüber, das ihn zu seiner Berufung geführt hatte.“
Kein Wunder, dass unser Beruf, der sich sowohl um die alltäglichen als auch um die fast unglaublichen wahren Geschichten im Leben von Menschen dreht, immer auch schon interessant als Schablone für spannende fiktionale Geschichten war.
In Filmen des zwanzigsten Jahrhunderts war das Bild von psychotherapeutischen und psychiatrisch Tätigen dabei noch meist von Ängsten und Befürchtungen geprägt, die mit der Vorstellung eines so tiefen und exklusiven Vertrauensverhältnisses, wie es Psychotherapien erfordern, verbunden sein können: Psychiater und Psychotherapeuten waren meist nicht nur weiß, männlich und alt, sondern überdies in der Regel selbst mehr oder weniger verrückt. Von vertrottelten Neurotikern bis zu manipulativen Serienmördern und Menschenfressern (hier ein Review dazu: www.psychiatrictimes.com/articles/stigma-continues-hollywood).
In den moderneren Filmen und Serien des 21. Jahrhunderts hat sich die fiktionale Kolleg*innenschaft diversifiziert und ist realistischer geworden: Meist sind die Psychotherapeut*innen einigermaßen kompetent und wohlwollend, häufig haben sie eher „normale“ Probleme im Privatleben, die mit der gruseligen Mysthifizierung des Berufsstandes brechen und die Psychotherapeut*innen menschlich und relateable machen.
Eine besonders realitätsnahe Darstellung psychotherapeutischer Arbeit und auch der dazugehörigen Reflexionsprozesse ist dem ZDF mit Safe geglückt. Zudem zeigt die Serie Kinder- und Jugendlichentherapien, was recht selten ist, meist sind in Serien Erwachsene die Patient*innen. Die Darstellung der psychoanalytisch ausgerichteten Therapien in der Serie ist sogar so realistisch, dass Kolleg*innen sie zum Teil empfunden haben, als würde man sich selbst bei der Arbeit zusehen. Ein bisschen ging es mir auch so.
Ganz besonders hat mich natürlich die Szene gefreut, in welcher der Therapeut Tom einen Film nutzt, um seinem jugendlichen Patienten Sam etwas zu vermitteln: „Nichts steht geschrieben!“ sagt Lawrence von Arabien in dem gleichnamigen Filmklassiker von 1962 und widerspricht damit seinen fatalistischen Gefährten, die es für aussichtslos halten, den in der unbarmherzigen Wüste verschollenen Kameraden noch retten zu wollen. „Es (das Schicksal) steht geschrieben“ sagen sie. „Nichts steht geschrieben“ entgegnet Lawrence.
Dieses Zitat soll Sam veranschaulichen, dass auch sein Schicksal nicht vorherbestimmt und festgelegt ist. Ja, eine Vulnerabilität, d.h. ein gewisses Risiko bestimmte, auch psychische, Krankheiten zu entwickeln, ist genetisch determiniert und wird somit vererbt. Aber eben nur im Sinne einer erhöhten statistischen Wahrscheinlichkeit. Ebenso sind Temperament und bestimmte Persönlichkeitseigenschaften, wie Sams Impulsivität, in der Tendenz angeboren.
Welche Persönlichkeit ein Mensch jedoch letztendlich ausbildet und ob eine bestimmte Krankheit, in Sams Fall vielleicht eine Depression oder emotional-instabile Persönlichkeitsstörung, tatsächlich ausbricht, hängt auch noch von anderen, biographisch-sozialen Faktoren, wie z.B. den frühen Bindungserfahrungen ab. Man spricht daher vom bio-psycho-sozialen Modell von Krankheit bzw. Gesundheit. (bio = vererbte genetische Anlagen, psycho = angeborene Temperaments-/Persönlichkeitseigenschaften, sozial = prägende biographische Ereignisse und Lebensumstände).
Wenn ein Kind bspw. seine frühe soziale Umwelt als sicher und verlässlich erlebt, entwickelt es Urvertrauen in sich selbst und andere, ein Gefühl von Selbstwirksamkeit und Selbstwert und wird dadurch resilienter, d.h. widerstandsfähiger, auch gegen psychische Erkrankungen. Und letztlich spielen auch die Lebensumstände in der späteren Entwicklung eine Rolle: Chronischer Stress, Armut, Gewalterfahrungen und andere traumatische Erlebnisse wirken sich ungünstig auf die Gesundheit im Allgemeinen aus und können den Ausbruch von Krankheiten triggern.
Nun scheint es für Sam auf allen Ebenen – Genetik, frühe Bindungen und spätere Lebensereignisse – nicht gerade günstig auszusehen: Seine Eltern waren offenbar beide psychisch krank, die Mutter verlor er durch Suizid und er hat viel Ablehnung und Kritik aufgrund seiner Impulsivität und Regelverstöße erfahren. Genau darum ist das Filmbeispiel, das Sams Therapeut in Safe wählt, so passend: Auch für Lawrence von Arabien stehen die Chancen nicht gut. Und dennoch steht das Schicksal nicht geschrieben! Lawrence kann hier und jetzt seine persönlichen Ressourcen – Mut, Entschlossenheit, Reitkunst… – in die Waagschale werfen, um das Unwahrscheinliche möglich zu machen. Ebenso kann auch Sam sich entscheiden, kein Schläger oder Dieb zu sein und sich bei aller Frustration und Verzweiflung nicht umzubringen. Er kann die Hilfe seines Therapeuten und seiner Pflegeeltern annehmen und mit Mut, Entschlossenheit und Offenheit auf das Mädchen zugehen, das er mag. Er kann, um es mit Sensei Johnny Lawrence aus Cobra Kai zu sagen, „das Drehbuch umschreiben (flip the script)“, oder, in den Worten eines der lebensweisesten Philosophen aller Zeiten, des Stoikers Epiktet: „Vergegenwärtige dir einen Charakter, ein Musterbild, wonach du zu leben dir vornimmst, sowohl im privaten, als im öffentlichen Leben“ und sich somit selbst das Drehbuch, die Leitlinie seines eigenen Lebens – auch angesichts widriger Umstände – kreieren.
Der amerikanische Psychotherapeut Stanton Samenow, auf dessen Buch über Psychotherapie mit Straftäter*innen sich sogar Dr. Melfi in den Sopranos bezieht, hält auf seinem Blog selbst für dieses sicher sehr schwierige Patient*innenklientel fest: Es gibt immer Hoffnung auf Veränderung (hier der Link zum Post: www.psychologytoday.com/intl/blog/inside-the-criminal-mind/202102/does-psychotherapy-make-criminals-worse)
Fazit: Nicht nur wegen dieser sehr gelungenen Therapiesequenz ist Safe absolut sehenswert. Das zumindest steht geschrieben!