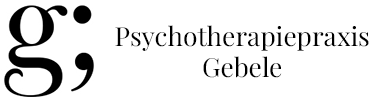In Breaking Bad können wir den Aufstieg (und Fall?) des Mittelschicht-Chemielehrers Walter White zum skrupellosen Drogendealer mit dem Pseudonym Heisenberg verfolgen. Die Handlung setzt ein, als Walter ein inoperabler Lungenkrebs diagnostiziert und eine Restlebenszeit von wenigen Jahren prognostiziert wird.
Über Walters Leben vor der Diagnose erfahren wir nur wenig. Offenbar war er einst ein äußerst begabter Chemiker, kreativ, wissbegierig und dadurch erfolgreich. Bis zu seinem fünfzigsten Geburtstag, an welchem er die Krebsdiagnose erhält, scheint er jedoch den Großteil seiner Vitalität eingebüßt zu haben. Was passiert ist, wissen wir nicht. Wahrscheinlich nur der Alltag und das Alter.
Als wir Walter kennenlernen, weist er die diagnostischen Merkmale einer Dysthymia(ICD-10: F34.1) auf, einer chronischen subdepressiven Verstimmung. Diese zeichnet sich dadurch aus, dass die Symptomatik nicht so stark ausgeprägt ist, wie bei einer manifesten depressiven Störung, dafür aber über mindestens zwei Jahre konstant oder wiederkehrend anhält. Bei Walter lassen sich die folgenden charakteristischen Symptome beobachten:
- Antriebslosigkeit
- Geringes Selbstvertrauen
- Verlust der Freude an Sexualität
- Sozialer Rückzug
- Verminderte Gesprächigkeit
Doch diese relativ rationale Ausgangsmotivation kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass dem eine plötzliche und fundamentale Veränderung von Walters Erlebens- und Verhaltensweisen zugrunde liegt: Der ehemals, im Rahmen seiner Dysthymia, überangepasste, stille und unterwürfige Walter neigt jetzt auf einmal zu Wutausbrüchen und impulsiver Aggressivität, ebenso wird eiskaltes kriminelles Kalkül sichtbar. Die depressive Stimmungslage schlägt in umtriebige Vitalität und aggressive Gereiztheit um, Antrieb und Libido sind gesteigert, der Selbstwert wirkt plötzlich erhöht, Empathie und soziale Anpassung sind verschwunden. Auffallend ungerührt begeht Walter nun Verbrechen, lügt, bricht Regeln und Versprechen, greift zu körperlicher Gewalt und psychologischer Manipulation.
Eine derart auffallende Veränderung der Erlebens- und Verhaltensweisen in direktem Zusammenhang mit einer starken psychosozialen Belastungssituation wird in der Psychopathologie als Anpassungsstörung bezeichnet. Da Walter überwiegend Symptome aus dem dissozialen Spektrum zeigt (Missachtung sozialer Normen, Empathielosigkeit), ist eine Anpassungsstörung mit vorwiegender Störung des Sozialverhaltens (ICD-10: F43.24) zu diagnostizieren.
Wie lässt sich nun diese massive Symptomverschiebung erklären? Wie wird aus einem depressiven Spießer quasi über Nacht ein gewalttätiger Drogendealer? Um das zu verstehen, müssen wir uns eingehender mit Walters Persönlichkeit und ihrer Psychodynamik befassen.
Der junge Walter, wir lernen ihn in einer Rückblende kennen, ist ein energischer, charismatischer und begabter Wissenschaftler. Er erzielt erste Erfolge, die ihn seiner überdurchschnittlichen Intelligenz und Begabung versichern. Die Welt steht ihm offen und er weiß das.
Doch die Welt bleibt Walter viel schuldig: der akademische Ruhm ist flüchtig und bleibt schließlich ganz aus. Weniger Begabte machen die großen Karrieren. Die verwöhnten Highschool-Kids, die er schließlich als Chemielehrer unterrichtet, respektieren ihn und seine Kenntnisse nicht. Ihre offene Geringschätzung wird ein Quell ständiger Kränkung. Wenngleich ihm die meisten intellektuell nicht gewachsen sind, steht nun ihnen die Welt offen, während er zum zuschauen verdammt ist.
Auch privat bleibt das große Glück aus. Attraktion und Erotik werden im Alltag des Ehelebens zerrieben, der Stammhalter ist behindert, sozial isoliert und zeigt kein Interesse daran, die hochfliegenden Träume des Vaters stellvertretend zu leben.
All dies, inklusive des entwürdigenden Zweitjobs als Autowäscher und der Angebereien seines Schwagers, der sich als männlich-kerniger Super-Drogenfahnder inszeniert, scheint Walter über Jahre hinweg geduldig zu ertragen: Er ist ein bescheidener Mann. Es könnte schlimmer sein.
Doch die früheren Träume von Großartigkeit, Einfluss und Anerkennung sind nicht einfach ausgelöscht, sie sind lediglich ins Unbewusste verdrängt worden, um den deprimierenden Alltag nicht durch Gedanken, wie alles hätte werden können, noch unerträglicher zu machen.
Die narzisstischen Fantasien über die eigene Person, wie und wer man selbst sein könnte, wenn nur die Umstände perfekt und die eigenen Schwächen besser unter Kontrolle wären, nennt die Psychologie Größenselbst. Es hat die Aufgabe, der heranwachsenden Persönlichkeit die Angst vor der großen, weiten Welt zu nehmen, indem sie beeinflussbar, ja beherrschbar wirkt, und dadurch Entwicklung zu ermöglichen. Auch schützt das Größenselbst das Ich vor allzu großen Selbstzweifeln und Resignation angesichts der alltäglichen Kränkungen und Insuffizienzen.
Walters Größenselbst ist zwar tief ins Unbewusste verdrängt, doch dort wartet es, lauert. Während das Bewusstsein Kränkung um Kränkung stoisch einsteckt, wächst das unbewusste Größenselbst kompensatorisch umso mehr. Geltungsdrang, Rachegelüste, hedonistische Bedürfnisse werden zugunsten der emotionalen Abstumpfung, die den Alltag erträglich macht, ins Unbewusste verschoben und nähren dort das Größenselbst.
Und dessen Stunde schlägt schließlich: Die erschütternde Diagnose ist die ultimative Kränkung, die finale Ungerechtigkeit. Das Leiden, Ertragen, Funktionieren werden nicht belohnt, es wird kein Happy End geben, die fetten Jahre folgen nicht mehr, nach den vielen dürren soll einfach Schluss sein. Walters psychische Überlebensstrategie ist gescheitert.
Die zu erwartende Konsequenz, nach der initialen Schockstarre, wäre der völlige Zusammenbruch: Verzweiflung, Resignation, Depression, vielleicht Suizid. Doch anstelle der totalen Depression, tritt das lange verdrängte Größenselbst. Verzweiflung und Hilflosigkeit werden jetzt verdrängt, um den Zusammenbruch zu verhindern. Das Ich kämpft mit allen Mitteln ums Überleben. Vom Tode bedroht, schwingt sich Walter selbst zum Herrn über diesen auf. Seine eigene, akute Sterblichkeit wird verleugnet, von Behandlungsoptionen will er nichts wissen. Im Mord an seinen Kontrahenten im Drogenbusiness ist er es, der den Tod beherrscht. Warum Walter White, der Langweiler mit dem deprimierenden Leben und dem unwürdigen Tod sein, wenn man Heisenberg sein kann, gottgleiches Genie, Nobelpreisträger – oder Drogenbaron.
Das Leben, die Gesellschaft, sie haben Walter White nichts geschenkt – Heisenberg schuldet ihnen nichts.