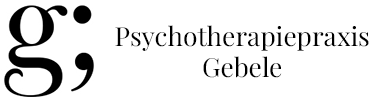Endlich eine überzeugende Darstellung der Borderline-Persönlichkeitsstörung in einer Fernsehserie! Der Störung, die fast jeder zu kennen glaubt und über die es doch so viele falsche Klischees, gefährliches Halbwissen und stigmatisierende Vorurteile gibt, wie über kaum eine andere.
Zeit, mit einigen dieser falschen Mythen aufzuräumen! Dabei hilft uns die beeindruckende (wenn auch im Dienste eines spektakulären Plots dramatisierte) Darstellung einer „Borderlinerin“ in Bates Motel. Die Rede ist natürlich von Norma Bates, der Mutter des späteren Psycho-Killers Norman Bates.
Die emotional-instabile Persönlichkeitsstörung vom Borderline-Typus, wie die Störung offiziell in der internationalen Klassifikation psychischer Störungen (ICD-10: F60.31) heißt, zeigt sich bei Norma anhand der folgenden, dauerhaft und situationsübergreifend vorliegenden Symptome:
- Deutliche Tendenz unerwartet und ohne Berücksichtigung der Konsequenzen zu handeln (Impulsivität)
- Deutliche Tendenz zu Streitereien und Konflikten
- Neigung zu Ausbrüchen von Wut oder Gewalt mit Unfähigkeit zur Kontrolle explosiven Verhaltens
- Unbeständige und unberechenbare Stimmung
- Störungen und Unsicherheit bezüglich Selbstbild und/oder Zielen und/oder Vorlieben
- Neigung, sich in intensive aber instabile Beziehungen einzulassen, oft mit der Folge von emotionalen Krisen
- Angst davor, Verlassen zu werden und übertriebene Bemühungen, dies zu vermeiden
- Anhaltende Gefühle von Leere und/oder Einsamkeit
Norma ist überaus impulsiv und beschwört durch ihre Impulsivität immer wieder Konflikte herauf. In diesen kämpft sie ohne Rücksicht auf die Konsequenzen, so dass es im Affekt auch schonmal zum Mord kommt – immerhin geht es ja auch um das Prequel zu Psycho!
Ihre Stimmung kann von einer Sekunde auf die andere, anhand einer einzelnen Äußerung oder Handlung ihres Gegenübers, radikal umschlagen, wobei das Spektrum von überschwänglicher Zuneigung über eiskalte Ablehnung bis hin zum Tobsuchtsanfall reicht.
Auch Normas Lebensplanung wirkt impulsiv und von tiefgreifender Unsicherheit bezüglich ihres Selbstbilds und ihrer Lebensziele geprägt. So geht sie immer wieder Beziehungen zu Männern ein, mit denen sie schon bald nicht mehr glücklich ist. Bei Problemen stellt sie schnell alles infrage und versucht ihr ganzes Leben radikal umzukrempeln indem sie irgendwo anders ein neues Leben beginnt.
Besonders auffallend – und für die Entwicklung ihres Sohnes Norman prägend – ist Normas panische Angst, von ihm verlassen zu werden. Sie scheint ihren Sohn weniger als eigenständige Person, sondern vielmehr als Teil ihrer selbst zu betrachten, ohne den sie sich leer und unerträglich einsam fühlen würde, was Norma unbewusst durch den Namen, den sie ihrem Sohn gegeben hat, zum Ausdruck bringt. Psychologen sprechen in einem solchen Fall von einem Selbstobjekt: Der andere wird nicht um seiner selbst willen begehrt, sondern nur zur Sicherung des eigenen Selbstwertgefühls. Beim leisesten Anzeichen für eine mögliche Verselbstständigung ihres Sohnes, reagiert Norma extrem wütend, verzweifelt oder gekränkt und setzt alles daran, Norman durch Schuldgefühle und Angst an sich zu binden.
All diese Erlebens- und Verhaltensweisen sind typisch für eine Borderline-Persönlichkeitsstörung. Jedoch sind die einzelnen Verhaltensweisen für die Diagnosestellung nicht hinreichend. Erst das zeitstabile und situationsübergreifende Vorliegen des charakteristischen Symptommusters und ein dadurch erheblich beeinträchtigtes persönliches und soziales Funktionsniveau rechtfertigen die Diagnose.
Kommen wir nun zu einigen der vielen Mythen über die Borderline-Persönlichkeitsstörung:
Borderliner sind Grenzgänger: Das mag in manchen Fällen so sein, die Bezeichnung Borderline-Störung impliziert jedoch nicht, dass Betroffene sich auf oder entlang irgendwelcher Grenzen (welcher denn auch?) bewegen. Der Begriff entstand vor dem Hintergrund der historischen Einteilung psychischer Erkrankungen in Neurosen (leichtere psychische Störungen aufgrund seelischer Konflikte, mit erhaltener Realitätswahrnehmung) und Psychosen (schwere psychische Störungen aufgrund organischer Ursachen, mit gestörter Realitätswahrnehmung). Da die frühen Beschreibungen der Borderline-Störung keiner der beiden Kategorien eindeutig zugeordnet werden konnten, wurden sie als „auf der Grenzlinie“ zwischen Neurose und Psychose liegend angesehen. In der modernen, viel differenzierten Psychopathologie spielen die Begriffe Neurose und Psychose eine weit weniger zentrale Rolle.
Fazit: Borderline ist ein historischer Begriff ohne inhaltlichen Bezug zum heutigen Störungsverständnis.
Borderliner verletzten sich selbst: Tatsächlich sind wiederholte Drohungen oder Handlungen mit Selbstverletzung (ICD-10) ein mögliches Symptom der Borderline-Persönlichkeitsstörung. In der klinischen Praxis lässt sich selbstverletzendes Verhalten, meist in Form von Ritzen, z.B. mit Rasierklingen, bei vielen Borderline-Patienten beobachten. Häufig dient die Selbstverletzung dem Abbau innerer Spannungszustände oder der Selbstbestrafung bei Scham- und Schuldgefühlen. Dennoch ist selbstverletzendes Verhalten kein notwendiges Kriterium, es gibt durchaus Borderline-Patienten, die sich nicht ritzen (zum Beispiel Norma Bates). Und vor allem ist selbstverletzendes Verhalten kein hinreichendes Kriterium: Ritzen oder andere selbstverletzende Verhaltensweisen können ebenso Symptome anderer psychischer Störungen (zum Beispiel Depressionen) sein oder auch bei an sich völlig gesunden Menschen als vorübergehendes Phänomen in Lebenskrisen, Erregungszuständen oder während der Pubertät auftreten.
Fazit: Borderline ist nicht gleich Ritzen und Ritzen ist nicht gleich Borderline.
Borderliner manipulieren und spalten: Wenn wir Angst haben, geliebte Personen für immer zu verlieren, ergreifen wir alle zur Verfügung stehenden Mittel, um dies zu verhindern. Ein drohendes oder befürchtetes Verlassenwerden kann bestehende Zweifel an der eigenen Liebenswürdigkeit und existenzielle Ängste vor Einsamkeit und Endlichkeit wachrufen. Wenn der innere oder äußere Krieg um geliebt oder verlassen werden tobt, kommen mitunter auch manipulative Waffen wie Schuldvorwürfe, Drohungen und emotionale Erpressung zum Einsatz. Die Spaltung in Gut und Böse, Liebe und Hass, Leben und Tod kann in solchen Ausnahmesituationen helfen, ein Mindestmaß an Orientierung und Sicherheit zu erhalten.
Fazit: Spaltung und Manipulation sind gängige psycho-soziale Bewältigungsstrategien bei existenzieller Verlassenheitsangst, allerdings geraten Menschen mit Borderline-Persönlichkeitsstörung tendenziell schneller und häufiger in diesen Zustand (siehe Norma Bates).
Eine Borderline-Störung ist die Folge eines Kindheitstraumas: Wie fast alle psychischen Störungen lässt sich auch die Borderline-Persönlichkeitsstörung in den meisten Fällen nicht auf eine einzelne Ursache zurückführen. Dennoch zeigt die klinische Beobachtung, dass sich in den Biographien von Menschen mit Borderline-Persönlichkeitsstörungen überzufällig häufig Gewalt- und Missbrauchserfahrungen finden lassen (wie auch bei Norma Bates), was nahe legt, dass diese einen Einfluss auf die Krankheitsentstehung haben. Allerdings gibt es auch Borderline-Persönlichkeitsstörungen ohne nachweisbares schweres Trauma in der Vorgeschichte, ebenso wie es viele Menschen mit Gewalt- und Missbrauchserfahrung gibt, die keine Borderline-Persönlichkeitsstörung entwickeln. Entscheidender als ein schweres Kindheitstrauma scheinen Bindungsstörungen zu sein, das heißt Störungen und negative Muster in der Eltern-Kind-Interaktion, wie emotionale Vernachlässigung, Entwertung oder inkonsistentes Elternverhalten zwischen Vereinnahmung und Zurückweisung. Allerdings treten schwere Traumatisierungen und Bindungsstörungen gehäuft in denselben Familiensystemen auf.
Fazit: Traumata stellen einen Risikofaktor für viele psychische Störungen dar, aber Borderline ist nicht gleich Trauma.
Die Borderline-Störung ist nicht therapierbar: Ob Persönlichkeitsstörungen generell vollständig heilbar sind, oder nicht, ist umstritten. Doch selbst wenn die zugrundeliegenden Erlebensweisen (wie im Falle der Borderline-Persönlichkeitsstörung die Tendenz zu Impulsivität, emotionaler Instabilität und Angst vor dem Verlassenwerden) nicht vollständig wegtherapiert werden können, bedeutet das nicht, dass Psychotherapie nicht indiziert, sinnvoll und aussichtsreich wäre. Die Therapie der Borderline-Persönlichkeitsstörung setzt an der Umsetzung des Erlebens in Verhalten an: Die eigenen Gefühle sollen früher und differenzierter wahrgenommen und analysiert werden können. Dadurch lässt sich das eigene Verhalten besser regulieren und zwischenmenschliche Interaktionen können befriedigender gestaltet werden. Langfristig werden dadurch positivere Beziehungserfahrungen gemacht und Selbstwertgefühl, Selbstvertrauen und das Vertrauen in andere können nachreifen. Allerdings fällt es Menschen mit Borderline-Persönlichkeitsstörungen aufgrund ihrer früheren enttäuschenden Beziehungserfahrungen oft nicht leicht, zu Therapeuten Vertrauen zu fassen. Norma Bates gelingt es gar nicht.
Fazit: Es gibt gute und wissenschaftlich fundierte Psychotherapieverfahren zur erfolgreichen Behandlung von Borderline-Persönlichkeitsstörungen, die allerdings von Therapeut und Patient viel Geduld und Offenheit für neue Erfahrungen erfordern.