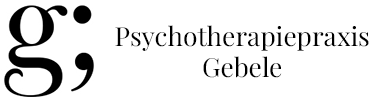Batman ist die, in einen High-Tech-Fledermaus-Kampfanzug gewandete, Tarnidentität des Milliardärs Bruce Wayne, mithilfe derer er nachts Verbrecher in den Straßen seiner Heimatstadt Gotham City jagt. Batmans Geschichte wird, nicht zum ersten Mal, im Rahmen der Filmtrilogie “Batman Begins”, “The Dark Knight” und “The Dark Knight Rises”, wie folgt erzählt:
Bruce Wayne wächst zunächst unter vermeintlich idealen Bedingungen auf. Besonders sein Vater scheint geradezu traumhaft gut zu sein: Selfmade-Milliardär, sozialer Wohltäter, liebender Ehemann und Vater. Umso mehr können wir annehmen, dass sich der kleine Bruce, angesichts dieses schier unerreichbaren Rollenvorbilds, schon früh mit Insuffizienz- und Minderwertigkeitsgefühlen herumzuschlagen hat. Allerdings müssen diese, um die dringend benötigte Fürsorge des Vaters nicht zu gefährden, ins Unbewusste verdrängt werden.
Erstmals erschüttert wird die heile Welt des Bruce Wayne durch den Sturz in einen dunklen Brunnenschacht, in welchem es von Fledermäusen wimmelt. In der Folge dieser als lebensbedrohlich erlebten Situation (aus welcher ihn schließlich sein Vater befreit!), entwickelt er eine posttraumatische Belastungsstörung (ICD-10: F43.1) mit den folgenden Symptomen:
- Wiederholtes Erleben des Traumas in sich aufdrängenden Erinnerungen (Nachhallerinnerungen, Flashbacks, Albträume)
- Innere Bedrängnis in Situationen, die der Belastung ähneln oder damit in Zusammenhang stehen
- Vermeidung von Umständen, die der Belastung ähneln
- Anhaltende Symptome einer erhöhten psychischen Sensitivität und Erregung (Ein- und Durchschlafstörungen, erhöhte Schreckhaftigkeit, Konzentrationsschwierigkeiten)
Die Angst in traumaassoziierten Situationen und der Drang diese zu vermeiden, führen dazu, dass Familie Wayne eine Oper, in deren Verlauf Fledermäuse umherflattern, vorzeitig durch einen Seiteneingang verlassen muss und das Elternpaar von einem Straßenräuber ermordet wird. Bruce entwickelt daraufhin starke Schuldgefühle. Dass er sich insgeheim manchmal vom übergroßen Schatten des Vaters frei gewünscht hätte, dürfte diese zusätzlich verstärkt haben.
Seine ohnmächtigen Schuldgefühle projiziert er auf den Täter und schmiedet irgendwann im Lauf der nächsten Jahre einen Racheplan, welchen er bei dessen Haftentlassung umzusetzen versucht. Bis dahin scheint ihn die Rachephantasie für ein äußerlich unauffälliges und leidlich erfolgreiches Leben als Student einer Eliteuni ausreichend stabilisiert zu haben. Als der unausgegorene Racheplan an der Realität scheitert, wirft die narzisstische Kränkung den jungen Mann in eine schwere Depression (ICD-10: F32.2), die sich in typisch männlicher Weise manifestiert:
- Sozialer Rückzug
- Zynismus
- Gereiztheit
- Parasuizidales Risikoverhalten
Trotz der, zum Markenzeichen stilisierten, Einzelgängerrolle bleibt Bruce insgeheim weiterhin von der Sehnsucht nach der verlorenen väterlichen Anerkennung und mütterlichen Geborgenheit getrieben, welche er beide auf seine Jugendliebe Rachel verschiebt, wobei er das gemeinsame Glück aber vermeidend in eine phantasierte Zukunft projiziert, wahrscheinlich aus Angst, Rachel durch seine untergründig empfundene Unvollkommenheit zu enttäuschen und/oder zu gefährden und dadurch (wie die Eltern) wieder zu verlieren.
Als Rachel (und mit ihr die Erlösungsphantasie) im zweiten Film “The Dark Knight” tatsächlich stirbt, wiederholen sich die Schulddepression und schließlich, zu Beginn des dritten Films “The Dark Knight Rises”, der bekannte Ausweg aus dieser durch die Flucht in die Rolle des maskierten Helden. Wieder wird die empfundene Schuld auf die Bösen projiziert und das Minderwertigkeitsgefühl durch die narzisstische Selbstglorifizierung als edler Rächer abgewehrt.
Bruce Wayne ist also gefangen in einem sich ständig neu inszenierenden Dilemma, einem chronisch misslingenden Beziehungsmuster: Zwar hat er den starken Wunsch von seinen Mitmenschen geliebt und angenommen zu werden. Jedoch ist er in seinem tiefsten Inneren davon überzeugt, den Erwartungen nicht genügen zu können (vermutlich aufgrund des idealisierten und unerreichbaren väterlichen Vorbilds). In dem subjektiven Zwang, sich perfekt und damit liebenswert zu präsentieren, spaltet er alle mit dem väterlichen Idealbild nicht vereinbaren Selbstaspekte (Angst, Rachsucht, Aggressivität, Bindungsängste, Depression…) mithilfe des heimlichen Alter-Egos Batman ab. Tragischerweise wird der nach außen wahrgenommene Bruce Wayne dadurch eindimensional und leer, vermag Andere nicht wirklich an sich zu binden (mit Ausnahme von Rachel in einer Mischung aus Nostalgie und Mitleid).
Der traurige, einsame Bruce Wayne kann einem wahrlich leid tun und man ist regelrecht dankbar, dass Hollywood ihm nach drei langen Filmen voller Leiden und zermürbenden Selbstzweifeln doch noch ein Happy End schenkt.
Gönnen wir also diesem leidgeprüften Batman sein wohlverdientes Glück und trinken mit Alfred einen Fernet Branca auf sein Wohl!
Mehr zur Dark Knight Trilogie gibt es auch im Charakterneurosen-Podcast Folge 20 zu hören!