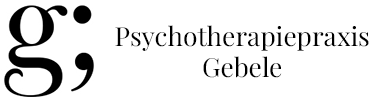Das Manuskript des Vortrages, den ich krankheitsbedingt leider nicht wie geplant beim Interdisciplinary College 2018 halten konnte, gibt es hier zum download.
Game of Thrones: Aryas Liste
Furcht ist der Weg zur dunklen Seite – Was uns Popkultur über Radikalisierung lehren kann
Einen längeren Text zur Psychologie von Radikalisierungsprozessen an Beispielen aus Star Wars, Harry Potter und The Walking Dead, basierend auf verschiedenen Vorträgen von mir, gibt es hier zum download.
To the Bone: Ellen
-
Der Gewichtsverlust ist selbst herbeigeführt durch Vermeidung von hochkalorischer Nahrung
-
Ellen hat eine Körperschemastörung, nimmt ihren viel zu dünnen Körper weiterhin als „zu fett“ wahr
-
Ellens Periode bleibt schon lange aus, als Folge der durch Nährstoffmangel entstandenen endokrinen Störung. Dieses Symptom nennt man Amenorrhoe.
Atypical: Das Interview
- Qualitative Abweichungen der wechselseitigen sozialen Interaktionen liegen vor: Sam hat Probleme mit dem Verständnis von Ironie und Sarkasmus, seine Intuition bzgl. sozialer Normen ist oft fehlerhaft und es fällt ihm schwer, Bedürfnisse und Gefühle anderer richtig einzuschätzen, wenn diese sie nicht ganz direkt formulieren.
- Sam zeigt ein eingeschränktes, stereotypes Repertoire von Interessen und Aktivitäten: Schule, Pinguine, Sex.
- Sams kognitive und sprachliche Fähigkeiten sind altersgemäß völlig normal entwickelt, vielleicht sogar ein bisschen überdurchschnittlich.
Tigermilch: Nini
-
Intelligenz, die ihr hilft, zumindest manche Situationen richtig zu verstehen und einzuordnen und immer wieder kreative Problemlösungen zu finden.
-
Humor, der ihr hilft, viele der belastenden, aber durch sie selbst nicht veränderbaren Lebensumstände besser auszuhalten.
-
Freundschaft: Mindestens eine stabile, positiv empfundene Bindung an eine Bezugsperson stellt einen der wichtigsten Resilienzfaktoren dar. Für Nini ist das ihre Freundin Jameelah. Zumindest solange diese nicht abgeschoben wird…
13 Reasons Why/Tote Mädchen lügen nicht – Staffel 1
Die Simpsons: Bart
-
Unaufmerksamkeit, z.B. Flüchtigkeitsfehler, Ablenkbarkeit, Schwierigkeiten zuzuhören, geringes Durchhaltevermögen bei als uninteressant erlebten Tätigkeiten
-
Hyperaktivität, z.B. Zappeln mit Händen und Füßen, Herumspringen und –klettern in Situationen die Stillsitzen erfordern, allgemein lautes Verhalten, Schwierigkeiten sich ruhig zu beschäftigen
-
Impulsivität, z.B. Unterbrechen oder stören anderer, Gesteigerter Redebedarf ohne Rücksicht auf soziale Konventionen, Ungeduld, Unfähigkeit zum Aufschieben eigener Bedürfnisse
-
Störungen des Sozialverhaltens, z.B. Missachten von Regeln, Verweigerung gegenüber Forderungen von Autoritäten, Unüberlegtes Handeln, das andere ärgert, Lügen um Strafen oder Verpflichtungen zu umgehen, Zerstörung fremden Eigentums
Dr. House: Dr. House
Seit ich vor fast vier Jahren angefangen habe, diesen Blog zu schreiben, wurde mir immer wieder Dr. House aus der gleichnamigen Serie nahegelegt. Für den Charakterneurosen-Podcast habe ich mich jetzt mal mit ihm befasst.
Eines gleich vorweg: Nein, Dr. House hat keine Narzisstische Persönlichkeitsstörung! Von den Diagnosekriterien nach ICD-10 (F60.80) erfüllt er nicht die für die Diagnose notwendigen fünf, sondern allenfalls drei:
-
Gefühl der eigenen Grandiosität und Wichtigkeit
-
Phantasien von Erfolg, Macht, Brillanz, Schönheit oder idealer Liebe
-
Überzeugung besonders und einzigartig zu sein und nur von anderen besonderen oder wichtigen Menschen (oder Institutionen) verstanden zu werden oder mit diesen verkehren zu müssen
-
Bedürfnis nach exzessiver Bewunderung
-
Anspruchsdenken und Erwartung bevorzugter Behandlung
-
Ausbeuterische Haltung in zwischenmenschlichen Beziehungen
-
Mangel an Empathie
-
Neid auf andere und/oder Überzeugung, von anderen beneidet zu werden
-
Arrogante und hochmütige Verhaltensweisen oder Ansichten
Doch dass wir die narzisstische Persönlichkeitsstörung ausschließen können, bedeutet nicht, dass Dr. House ein gesunder Mann wäre.
Zunächst einmal fällt die, in der Serie auch immer wieder thematisierte, Schmerzstörung ins Auge. Dr. House hat eine Chronische Schmerzstörung mit somatischen und psychischen Faktoren (ICD-10: F45.41). Diese ist definiert durch „einen mindestens 6 Monate andauernden intensiven und quälenden Schmerz in einem Körperteil, der nicht ausreichend durch eine körperliche Störung oder ein physiologisches Geschehen erklärt werden kann“.
Seine Schmerzen sind die Folge einer missglückten Operation am Bein, zeigen jedoch auch deutliche Zusammenhänge mit seinem emotionalen Befinden: Je einsamer, pessimistischer, misanthropischer und vor allem weniger verbunden mit seiner sozialen Umwelt er sich fühlt, umso stärker scheint er sie zu erleben und auch zu thematisieren, wohingegen er in Phasen erhöhten Selbstwertgefühls aufgrund beruflicher Herausforderungen und Leistungen oder in seltenen Momenten wahrer zwischenmenschlicher Verbundenheit, deutlich weniger eingeschränkt erscheint.
Aus der Chronischen Schmerzstörungen scheinen sich sekundär zwei weitere psychische Störungen zu ergeben
Erstens, eine Abhängigkeit von dem opioidhaltigen starken Schmerzmittel Vicodin. Eine Opioidabhängigkeit ist nach der internationalen Klassifikation psychischer Störungen (ICD-10: F11.2) gekennzeichnet durch drei oder mehr der folgenden Kriterien:
-
Starkes Verlangen, die Substanz zu konsumieren
-
Verminderte Kontrolle oder Kontrollverlust über Beginn, Beendigung oder Menge des Konsums
-
Körperliche Entzugserscheinungen, wenn die Substanz reduziert oder abgesetzt wird
-
Toleranzentwicklung, d.h. es müssen immer größere Mengen konsumiert werden, um den gewünschten Effekt zu erzielen
-
Gedankliche Einengung auf den Konsum, d.h. Aufgabe oder Vernachlässigung von Interessen und Verpflichtungen
-
Fortgesetzter Substanzkonsum trotz eindeutig schädlicher Folgen
Zweitens, scheint Dr. House unter einem Syndrom zu leiden, das als Male Depression, also „männliche Depression“, bezeichnet wird. Die klassischen Depressionssymptome Niedergeschlagenheit, Interessens- und Freudverlust sowie Antriebslosigkeit treten statistisch gesehen doppelt so häufig bei Frauen wie bei Männern auf, was dazu führt, dass Depressionen bei Männern vermutlich häufiger übersehen werden. Männer hingegen zeigen häufiger andere, weniger offensichtliche depressive Symptome, wie
-
Gereiztheit
-
Zynismus
-
Aggressivität
-
Dissoziales/delinquentes Verhalten
-
Risikoverhalten
-
exzessives Arbeiten („Flucht in die Arbeit“)
-
Suchtmittelmissbrauch
Dr. House zeigt die typisch depressive negative Weltsicht, die als kognitive Triade bezeichnet wird:
-
Negatives Selbstbild
-
Negatives Bild von der Welt
-
Negative Erwartungen für die Zukunft
Die Wahrnehmung seiner sozialen Umwelt als insuffizient und unehrlich führt zu emotionalem Rückzug und Feindseligkeit, welche wiederum Ablehnung und Gegenaggression auslösen. Dadurch chronifiziert sich ein Zustand von Einsamkeit und dem Erleben, nicht dazuzugehören und nicht gemocht zu werden. Wie hartnäckig diese Selbstwahrnehmung ist, zeigt sich unter anderem darin, dass Dr. House mit Komplimenten, Freundlichkeit oder Fürsorge kaum umgehen kann und reflexhaft zynisch oder aggressiv reagiert. Letztendlich verstärkt aber diese soziale Isolation durch das Zurückgeworfensein auf das eigene innere Erleben die Beschäftigung mit dem Schmerz und steigert somit dessen wahrgenommene Intensität. Der Versuch, diese mit Vicodin zu lindern, führt zu zusätzlichen sozialen Problemen.
Psychodynamisch erfüllt der Schmerz hier auch die Funktion, die Gefühle, welche Dr. House in seiner bewussten Selbstwahrnehmung schon lange resigniert aufgegeben hat, wie seine Wünsche nach Liebe, Versorgung, Zuneigung und auch die Hoffnung, diese noch zu erleben, im Unbewussten weiter artikulieren zu können. Die Selbstinszenierung als Leidender, Kranker, körperlich Schwacher („Krüppel“ wie Dr. House sagen würde) erlaub unbewusst die Identifikation mit der eigenen emotionalen Bedürftigkeit und ein heimliches Signal an die Umwelt: Helft mir!
Mehr über Dr. House gibt es im Charakterneurosen-Podcast zu hören
The Walking Dead: Negan
Negan aus The Walking Dead ist ein beeindruckender Bösewicht. Schon vor seinem ersten Auftritt in der Serie wurde viel über die aus den Comics bekannten Figur spekuliert und auch in der Serie selbst schien sich die Präsenz eines mächtigen Gegenspielers sich bereits im Vorfeld subtil atmosphärisch abzuzeichnen.
Aus psychotherapeutischer Sicht ist das erste Kennenlernen einer Person, im Falle der Therapie die sogenannte Eingangsszene, von großem Interessen, da wir davon ausgehen, dass Patienten uns im ersten Kontakt besonders deutlich die Informationen liefern, welche sie – bewusst oder unbewusst – als wichtige Angaben über sich selbst und damit als relevant für die Therapie erachten.
Dabei unterscheidet man drei Formen von Information:
-
Objektive Informationen: Fakten und Daten, die objektiv überprüfbar sind
-
Subjektiv Information: Die emotionale Bedeutung, die der Patient bestimmten Daten und Fakten persönlich verleiht. Diese ist ihm bewusst und kann dem Therapeuten (ggf. auf Nachfrage) mitgeteilt werden.
-
Szenische Informationen: Durch die Gestaltung der Szene, also durch Auftreten, Körpersprache, Ausdrucksweise etc. teilt der Patient unbewusst Informationen über sich selbst mit. Diese können mit den objektiven und subjektiven Informationen übereinstimmen, oder aber diesen widersprechen.
 Eine weitere wichtige szenische Information ist seine vermeintliche Unberechenbarkeit. Niemand soll sich allzu sicher fühlen. Daher wird er immer wieder überraschend laut, wechselt die Gangrichtung, wendet sich mal dem einen, dann spontan dem anderen zu, täuscht Angriffe an um sie wieder abzubrechen oder doch überraschend an anderer Stelle zuzuschlagen. Auch diese Information sendet Negan bewusst und absichtlich.
Eine weitere wichtige szenische Information ist seine vermeintliche Unberechenbarkeit. Niemand soll sich allzu sicher fühlen. Daher wird er immer wieder überraschend laut, wechselt die Gangrichtung, wendet sich mal dem einen, dann spontan dem anderen zu, täuscht Angriffe an um sie wieder abzubrechen oder doch überraschend an anderer Stelle zuzuschlagen. Auch diese Information sendet Negan bewusst und absichtlich.-
Das exzessive Bedürfnis nach Bewunderung und
-
das Gefühl nur mit einigen wenigen, ebenfalls besonderen Personen auf Augenhöhe sein zu können.
-
Gefühl der eigenen Grandiosität und Wichtigkeit
-
Intensives Streben nach Erfolg und Macht
-
Anspruchsdenken und Erwartung bevorzugter Behandlung
-
Ausbeuterische Haltung in zwischenmenschlichen Beziehungen
-
Mangel an Empathie
-
Die Überzeugung, von anderen beneidet zu werden
-
Arrogante und hochmütige Verhaltensweisen oder Ansichten
Mit The Walking Dead und Negan befassen wir uns auch im Charakterneurosen-Podcast