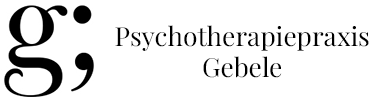Adrian Monks Biographie ist durch mehrere schwere Verlusterlebnisse gekennzeichnet, die in ihm eine tiefe Verunsicherung und Angst sowie ein überwertiges Bedürfnis nach Sicherheit und Verlässlichkeit ausgelöst haben. Psychopathologisch schlägt sich dies in der Kombination einer Phobischen Störung und einer Zwangsstörung nieder.
Hand of God: Pernell
- Wahn
- Akustische Halluzinationen in Form von kommentierenden und dialogischen Stimmen
- Optische Halluzinationen
- Gedankeneingebung: Überzeugung dass eigene Gedanken von außen (von Gott) geschickt wurden
- Gedankenabreisen: Unterbrechung des Denkflusses (bei Pernell durch das plötzliche Einschießen von Einfällen im Zusammenhang mit seinem Wahn)
Terminator 2: Sarah Connor
Sarah Connor gilt, insbesondere in Terminator 2 – Tag der Abrechnung, als eine der stärksten weiblichen Heldenfiguren des Actionkinos. Dennoch befindet sie sich zu Beginn des Films in einer überaus hilflosen Lage, nämlich zwangseingewiesen in einer geschlossenen forensischen Psychiatrie.
- Symptomen einer Schizophrenie, z.B. Wahn und
- Symptomen einer Affektiven Störung, also entweder
- einer Depression (gedrückte Stimmung, Freudlosigkeit, Antriebsminderung) oder
- einer Manie (situationsunangemessen gehobene Stimmung, Gereiztheit, Antriebssteigerung, Größenwahn)
- Ein Erlebnis von außergewöhnlicher Bedrohung, z.B. von einem Terminator gejagt und mehrfach fast getötet zu werden
- Anhaltende Erinnerungen an das traumatische Erlebnis oder wiederholtes Erleben des Traumas in sich aufdrängenden Erinnerungen, z.B. Tagträume vom Ende der Welt
- Innere Bedrängnis in Situationen, die der Belastung ähneln oder damit in Zusammenhang stehen, z.B. unverhofft auf der Flucht aus dem Krankenhaus auf genau das Terminator-Modell zu treffen, von welchem man gejagt und mehrfach fast getötet wurde
- Erhöhte psychische Sensitivität und Erregung, z.B. Gereiztheit, Schreckhaftigkeit, erhöhte Wachsamkeit, Impulsivität…
Gone Girl: Amy
Die bisher drei Romane der amerikanischen Autorin Gillian Flynn sind allesamt nicht nur spannend, sondern zeichnen sich durch eine außerordentliche und zumindest im Thriller-Genre beklagenswert seltene psychologische Tiefe und ein starkes Gespür für den Facettenreichtum und die Ambivalenzen menschlichen Denkens und Fühlens aus.
- Herzloses Unbeteiligtsein gegenüber den Gefühlen anderer
- Deutliche und andauernde verantwortungslose Haltung und Missachtung sozialer Normen, Regeln und Verpflichtungen
- Unfähigkeit zur Aufrechterhaltung dauerhafter Beziehungen, obwohl keine Schwierigkeit besteht, sie einzugehen
- Sehr geringe Frustrationstoleranz und niedrige Schwelle für aggressives, einschließlich gewalttätiges Verhalten
- Fehlendes Schuldbewusstsein oder Unfähigkeit, aus negativer Erfahrung, insbesondere Bestrafung, zu lernen
- Deutliche Neigung, andere zu beschuldigen oder plausible Rationalisierungen anzubieten für das Verhalten, durch welches die Betreffenden in Konflikt mit der Gesellschaft geraten sind
Orange Is the New Black: Mr. Caputo
In der dritten Staffel von Orange Is the New Black lernen wir Gefängnisdirektor Joe Caputo besser kennen und erfahren unter anderem – Achtung: Spoiler 😉 – dass er nicht in Gegenwart anderer Pinkeln kann. Dieses Phänomen – Paruresis genannt – ist gar nicht mal so selten. Schätzungen zufolge sind ca. sieben Prozent der Bevölkerung betroffen, neun von zehn Betroffenen sind Männer.
-
Furcht vor bestimmten sozialen Situationen, oft im Zusammenhang mit einer befürchteten sozialen Bewertung
-
Vermeidung der angstbesetzten Situation
So vermeidet es auch Mr. Caputo gleichzeitig mit anderen Männern am Urinal zu stehen und muss, falls es doch passiert, die Situation unter fadenscheinigen Ausreden und unverrichteter Dinge wieder verlassen.
Sons of Anarchy: Jax und die Sons
Die über sieben Staffeln erzählte Geschichte der Sons of Anarchy ist eine Geschichte von Treue und Verrat, Loyalität und Rivalität, Liebe und Verlust. Zentrale Themen des menschlichen Seins also.
Moby Dick: Ahab
Kapitän Ahab, in der 1956er Verfilmung von Moby Dick gespielt von Gregory Peck, ist ein finsterer Geselle. Seit der weiße Wal ihn entstellt und fast getötet hat, jagt er ihm durch die sieben Weltmeere nach, besessen vom Gedanken an Rache und bereit, dafür jedes Menschenleben, auch sein eigenes, zu opfern.
- Feindliche oder misstrauische Haltung
- Sozialer Rückzug
- Andauerndes Gefühl von Leere und Hoffnungslosigkeit
- Andauerndes Gefühl von Nervosität oder von Bedrohung
- Andauerndes Gefühl der Entfremdung (anders als die anderen zu sein), ggf. verbunden mit emotionaler Betäubung
The Walking Dead: Gruppenpsychologie
The Equalizer: McCall
Robert McCall, der Equalizer, lebt nach strengen Regeln und Ritualen. Wahrscheinlich hat er in seinem früheren Leben als Geheimagent gelernt, dass nur eiserne Disziplin und akribische Planung ihn gegen das Grauen schützen können, dem er ausgesetzt war. Dennoch muss er viel Schlimmes erlebt haben, denn auch Jahre nachdem er sich zur Ruhe gesetzt hat, findet er keinen ruhigen Schlaf und hält weiterhin an einem Leben voller Regeln, Routinen und Ritualen fest. Wahrscheinlich kann er sich nur auf diese Weise sicher und annähernd beruhigt fühlen. Der Ex-Agent weist deutliche Züge einer zwanghaften (oder auch anankastischen) Persönlichkeitsstörung auf. Für diese Diagnose müssen nach der internationalen Klassifikation psychischer Störungen (ICD-10: F60.5) mindestens vier der folgenden Symptome dauerhaft vorliegen:
- Übermäßige Vorsicht
- Ständige Beschäftigung mit Details, Regeln, Listen, Ordnung, Organisation und Planungen
- Perfektionismus
- Überzogene Gewissenhaftigkeit
- Unverhältnismäßige Leistungsbezogenheit
- Übermäßige Pedanterie und Befolgung von Konventionen
- Rigidität und Eigensinn
- Bestehen auf Unterordnung Anderer unter eigene Gewohnheiten
Shameless: Frank & Carl
In Shameless wird nicht nur die schwere Alkoholabhängigkeit von Frank Gallagher dargestellt, sondern auch die weitreichenden und gravierenden Auswirkungen, die seine Erkrankung auf alle Mitglieder seiner Familie hat.
- Starkes Verlangen, die Substanz zu konsumieren
- Verminderte Kontrolle oder Kontrollverlust über Beginn, Beendigung oder Menge des Konsums
- Körperliche Entzugserscheinungen, wenn die Substanz reduziert oder abgesetzt wird
- Toleranzentwicklung, d.h. es müssen immer größere Mengen konsumiert werden, um den gewünschten Effekt zu erzielen
- Gedankliche Einengung auf den Konsum, d.h. Aufgabe oder Vernachlässigung anderer Interessen und Verpflichtungen
- Fortgesetzter Substanzkonsum trotz eindeutig schädlicher Folgen