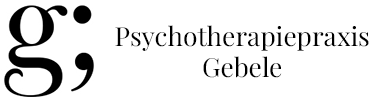Star Wars: Die Radikalisierung des Anakin S.
*Dieser Text wurde im Rahmen des Themenschwerpunktes „Radikalisierung“ auch auf filmschreiben.de veröffentlicht
Stromberg: Bernd Stromberg
Sein Verhaltensmuster könnte Hinweis auf Züge einer passiv-aggressiven Persönlichkeitsstörung sein. Personen mit dieser Störung fällt es schwer, soziale Konflikte offen auszutragen und ihre Meinungen und Gefühle direkt zum Ausdruck zu bringen. Stattdessen zeigen sie sich oberflächlich angepasst und willfährig, leisten aber passiven Widerstand durch Verweigerung oder Verzögerung von Aufgaben, geben Pflichten und Aggression nach Unten weiter und zeigen eine zynisch-frustrierte zwischenmenschliche Haltung.
Ursächlich könnte die Angst bzw. die Erfahrung sein, mit der eigenen Meinung und Persönlichkeit nicht wirklich gehört und wergeschätzt zu werden. Somit stellt die passiv-aggressive Persönlichkeitsstörung einen pathologischen Lösungsversuch des psychischen Konflikts zwischen resignativer Unterwerfung und weiterbestehenden Kontroll- und Selbstbehauptungswünschen dar.
Die passiv-aggressive Persönlichkeitsstörung wird in der in Deutschland verbindlichen Internationalen Klassifikation psychischer Störungen (ICD-10) nur im Anhang genannt (unter der Bezeichnung negativistische Persönlichkeitsstörung, ICD-10: F60.80). Detaillierte Diagnosekriterien finden sich in der in den USA gängigen Klassifikation Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-IV).
-
Widersetzt sich passiv der Erfüllung sozialer und beruflicher Routineaufgaben
-
Beklagt sich, von anderen missverstanden und missachtet zu werden
-
Ist mürrisch und streitsüchtig
-
Übt unangemessen Kritik an Autoritäten und verachtet sie
-
Bringt denen gegenüber Neid und Groll zum Ausdruck, die offensichtlich mehr Glück haben
-
Beklagt sich übertrieben und anhaltend über persönliches Unglück
-
Wechselt zwischen feindseligem Trotz und Reue
Flesh and Bone: Mia
Viele der Balletttänzerinnen in Flesh and Bone zeigen (worauf der Serientitel schon hinweist) Symptome von Essstörungen. Am deutlichsten ersichtlich werden diese bei Claires Mitbewohnerin Mia, deren Essstörung in der Serie auch thematisiert wird.
- Das Körpergewicht liegt unter einem Body-Mass-Index (BMI) von 17,5
- Der Gewichtsverlust ist selbst herbeigeführt durch Vermeidung von hochkalorischer Nahrung
- Körperschemastörung
- Amenorrhoe (Ausbleiben der Periode)
Der BMI wird nach folgender Formel berechnet: (Körpergewicht in kg) : (Körpergröße in m)². Bei Mias geschätzter Körpergröße von etwa 1,75 läge die Grenze bei einem Körpergewicht von 53,6 kg.
Flesh and Bone: Claire
 Das Titelbild der Starz-Miniserie zeigt eine dünne, fast nackte Tänzerin in düsterer, ebenso fast nackter Umgebung. Der Titel lautet Flesh and Bone. Setting ist das Ballett. Man muss nicht allzu kreativ sein, um sich auszumalen, dass es um Leistungsdruck, Selbstwertprobleme, Essstörungen und sexuellen Missbrauch gehen wird.
Das Titelbild der Starz-Miniserie zeigt eine dünne, fast nackte Tänzerin in düsterer, ebenso fast nackter Umgebung. Der Titel lautet Flesh and Bone. Setting ist das Ballett. Man muss nicht allzu kreativ sein, um sich auszumalen, dass es um Leistungsdruck, Selbstwertprobleme, Essstörungen und sexuellen Missbrauch gehen wird. Claires posttraumatische Belastungsstörung zeigt sich in Form der folgenden, charakteristischen Symptome:
-
Sie erlebt eine starke innere Bedrängnis in Situationen, die der Belastung ähneln oder damit in Zusammenhang stehen. Am offensichtlichsten ist dies bei Kontakt zu ihrem Bruder, dem Täter. Aber auch in anderen Situationen, in denen sich ihr Männer ungefragt oder unerwartet körperlich annähern, wie zum Beispiel ihr Tanzlehrer, Tanzpartner oder der Hauptsponsor des Balletts, fühlt sie sich sichtlich sehr unwohl.
-
Folglich versucht sie, entsprechende Situationen zu vermeiden. Sie bleibt gegenüber Männern distanziert und scheint keine Freude daran zu haben, sich verführerisch zu kleiden oder zu flirten.
-
Sie zeigt deutliche Symptome chronisch erhöhter psychischer Erregung, wie Hypervigilanz (erhöhte Wachsamkeit) und Schreckhaftigkeit (insbesondere bei Berührungen und im Kontakt mit Männern) sowie Einschlafstörungen.
 Drei weitere Aspekte von Claires posttraumatischer Belastungsstörung sind zwar für die Diagnosestellung nicht erforderlich, aber dennoch interessant genug, um eigens thematisiert zu werden.
Drei weitere Aspekte von Claires posttraumatischer Belastungsstörung sind zwar für die Diagnosestellung nicht erforderlich, aber dennoch interessant genug, um eigens thematisiert zu werden.
Into the Badlands: Trauma als Chance
 Die erste Staffel von Into the Badlands scheint erst der Auftakt zu einer längeren Geschichte zu sein und lässt uns über die weitere Handlung und die tieferen Themen, zugunsten des Schwerpunkts auf Ästhetik und Martial Arts-Action, zunächst noch im Unklaren.
Die erste Staffel von Into the Badlands scheint erst der Auftakt zu einer längeren Geschichte zu sein und lässt uns über die weitere Handlung und die tieferen Themen, zugunsten des Schwerpunkts auf Ästhetik und Martial Arts-Action, zunächst noch im Unklaren.Wohin die Reisen von Sunny und M.K. in Into the Badlands führen werden, wissen wir noch nicht – die erste Staffel scheint eher dem Zweck zu dienen uns klar zu machen, woher, sprich: Aus welcher äußeren und inneren Situation, die beiden kommen. Die Welt von Into the Badlands ist eine Welt des Traumas, wie uns bereits im Intro der ersten Folge vermittelt wird: Die Kriege liegen so lange zurück, dass sich niemand mehr an sie erinnert. Dunkelheit und Angst regierten das Land… Diese Welt wurde auf Blut errichtet. Hier ist niemand mehr unschuldig.
- Sunny ist ein Waisenkind und Kindersoldat, der bereits als Knabe töten musste um nicht selbst getötet zu werden und bis heute unzählige Male dazu gezwungen war.
- Gleiches gilt für Quinn.
- M.K. wurde entführt, seine Angehörigen ermordet.
- Auch Ryder wurde entführt und dabei noch gefoltert.
- Tilda wurde sexuell missbraucht.
- Veil verliert ihre Eltern auf brutale Weise.
Transparent: Die Geschichte von Mort und Maura
In den ersten Folgen begleiten wir Mort bei einem schrittweisen Outing und erleben, wie sein Umfeld darauf reagiert. Auch Morts Ängste vor Ablehnung und Stigmatisierung werden in seiner Vorsicht, seinem Zögern deutlich – gerade gegenüber den eigenen Kindern, da ihm die Beziehungen zu diesen besonders viel bedeuten.
Tatsächlich fällt es den Kindern nicht leicht, mit der äußeren Veränderung ihres Vaters umzugehen. Obwohl sie ihn lieben. Obwohl sie allesamt liberal und weltoffen eingestellt sind. Trotz eines gewissen Hangs zu sexueller Unkonventionalität und Experimentierfreude. Und obwohl sie selbst immer wieder Mühe damit haben, herauszufinden, wer und wie sie eigentlich sind.
Auch die Psychiatrie hat sich mit der Akzeptanz von Transsexualität bisher schwer getan. Während der überwiegende Teil praktisch tätiger Psychotherapeuten Transsexualität nicht als krankhaft begreift, findet sie sich in der aktuellen internationalen Klassifikation psychischer Störungen (ICD-10: F64.0) unter der Rubrik Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen noch immer als Störung der Geschlechtsidentität unter der folgenden Definition:
Konstanter Wunsch, als Angehöriger der andren Geschlechtes zu leben und als solcher akzeptiert zu werden, in der Regel (aber nicht zwingend) verbunden mit dem Wunsch, den eigenen Körper durch chirurgische und hormonelle Behandlungen dem bevorzugten Geschlecht anzugleichen.
Es gehört zur traurigen Geschichte der Psychiatrie, dass die Notwendigkeit, Krankheiten zu definieren, immer wieder zur Pathologisierung von Erleben und Verhalten führt, das von der Norm, also vom Durchschnitt abweicht. So wurde zum Beispiel Homosexualität erst 1992 (!) mit erscheinen der zehnten Auflage der internationalen Krankheitsklassifikation (ICD-10) aus dem Katalog psychischer Störungen gestrichen und als gesunde Variante menschlichen Seins anerkannt.
In der elften Auflage (ICD-11), die voraussichtlich 2017 verbindlich eingeführt werden soll, wird sich auch die Transsexualität nicht mehr als psychische Störung finden.
Andere Fragen bleiben hingegen offen: Wann wird Traurigkeit zur Depression, wann Aufgedrehtheit zur Hyperaktivität, PMS zur Prämenstruellen dysphorischen Störung…
Fakt ist – und das lehrt uns, nicht nur an Mauras Beispiel, auch Transparent mit seinen vielen unkonventionellen und mehrschichtigen Figuren – dass Menschen unterschiedlich sind und jeder Mensch in vielerlei Hinsicht mehr oder weniger stark vom Durchschnitt abweicht. Wer darunter leidet braucht Hilfe, die anderen Verständnis und Respekt.
Mr. Robot: Elliot
 Elliot Alderson aus Mr. Robot hat zunächst eine recht typische soziale Phobie, das heißt er hat Angst vor sozialen Situationen, also Essenseinladungen, Small-Talk usw. In der internationalen Klassifikation psychischer Störungen (ICD-10: F40.1) ist diese durch die folgenden Symptome definiert:
Elliot Alderson aus Mr. Robot hat zunächst eine recht typische soziale Phobie, das heißt er hat Angst vor sozialen Situationen, also Essenseinladungen, Small-Talk usw. In der internationalen Klassifikation psychischer Störungen (ICD-10: F40.1) ist diese durch die folgenden Symptome definiert: - Deutliche Furcht im Zentrum der Aufmerksamkeit zu stehen oder sich peinlich oder erniedrigend zu verhalten
- Deutliche Vermeidung im Zentrum der Aufmerksamkeit zu stehen oder von Situationen, in denen die Furcht besteht, sich peinlich oder erniedrigend zu verhalten
- Mindestens zwei Angstsymptome in den gefürchteten Situationen, z.B. Erröten, Zittern, Schwitzen etc.
- Deutliche emotionale Belastung durch die Angstsymptome oder das Vermeidungsverhalten.
- Einsicht dass die Symptome oder das Vermeidungsverhalten übertrieben und unvernünftig sind
- Die Symptome beschränken sich ausschließlich oder vornehmlich auf die gefürchteten Situationen oder auf Gedanken an diese
- Starkes Verlangen, die Substanz zu konsumieren
- Verminderte Kontrolle oder Kontrollverlust über Beginn, Beendigung oder Menge des Konsums
- Körperliche Entzugserscheinungen, wenn die Substanz reduziert oder abgesetzt wird
- Toleranzentwicklung, d.h. es müssen immer größere Mengen konsumiert werden, um den gewünschten Effekt zu erzielen
- Gedankliche Einengung auf den Konsum, d.h. Aufgabe oder Vernachlässigung von Interessen und Verpflichtungen
- Fortgesetzter Substanzkonsum trotz eindeutig schädlicher Folgen
- Zwei oder mehr unterschiedliche Persönlichkeiten innerhalb eines Individuums, von denen zu einem bestimmten Zeitpunkt jeweils eine in Erscheinung tritt
- Jede Persönlichkeit hat ihr eigenes Gedächtnis, ihre eigenen Vorlieben und Verhaltensweisen und übernimmt zu einer bestimmten Zeit, auch wiederholt, die volle Kontrolle über das Verhalten der Betroffenen
- Unfähigkeit, wichtige persönliche Informationen zu erinnern
- Überzeugender zeitlicher Zusammenhang zwischen den Symptomen und belastenden Ereignissen, Problemen oder Bedürfnissen
Dass Elliots multiple Persönlichkeitsstörung ausbricht, hängt maßgeblich mit der Angst und dem Stress zusammen, die er aufgrund seiner sozialen Phobie hat. Auch der Drogenmissbrauch könnte hierzu beigetragen haben. Als er sich immer mehr einsam, verlassen und überfordert fühlt, spaltet er einen Teil seiner Persönlichkeit unbewusst innerlich ab. Dieser Persönlichkeitsanteil erhält die Gestalt seines Vaters, vor dem er zwar große Angst hat, den er aber auch als stark und mächtig erlebt hat. Ohne es zu wissen, erhofft er sich von seinem Vater, dass diese seine Probleme löst und die großen Herausforderungen bewältigt.
Jessica Jones
 |
| Netflix-Werbung am Stuttgarter Hbf 2015, Foto: Gebele |
Ein Beitrag von mir über das Identifikationspotential von SerienheldInnen am Beispiel von Jessica Jones findet sich jetzt auf filmschreiben.de
True Detective: Ani
Starke weibliche Hauptrollen sind in Mainstreamfilmen und -serien rar gesät. Antigone „Ani“ Bezzerides aus der zweiten Staffel von True Detective bildet hier eine rühmliche Ausnahme.
- Verdrängung: Als Verdrängung wird das (vollständige oder teilweise) Vergessen des Erlebten bezeichnet. Ani scheint sich zwar zu erinnern, dass sie als Kind in der Kommune ihres Vaters sexuell missbraucht worden ist, die Details der Erinnerung scheinen aber zunächst verdrängt zu sein.
- Reaktionsbildung: In der Missbrauchssituation hat sich Ani wehrlos und schwach erlebt. Als Erwachsene arbeitet sie hart daran, sich immer genau gegenteilig zu fühlen. Das nennt die Psychologie Reaktionsbildung. Sie trainiert hart, trägt immer Messer bei sich, ist eher aggressiv als ängstlich. Auch ihre Berufswahl (Polizistin) lässt den Wunsch nach Stärke und Selbstsicherheit erkennen. Über ihre sexuellen Vorlieben erfahren wir nichts genaues, es wird aber in der ersten Folge angedeutet, dass sie auch hier in der Lage ist, ihren Sexualpartner ziemlich einzuschüchtern.
- Projektion: Wir wissen nicht genau, inwieweit Anis Sorge um ihre in der Erotikbranche tätige Schwester berechtigt ist. Sollte es so sein, wie ihre Schwester behauptet, dass sie nämlich selbstbestimmt nur das tut, was sie möchte, könnte Anis Sorge um sie zum Teil eine Projektion sein. Das bedeutet, Ani überträgt ihr eigenes Gefühl, Opfer von sexueller Gewalt geworden zu sein, auf ihre Schwester und kann dann versuchen, diese zu beschützen, nun da sie eine toughe Polizistin ist, während sie sich selbst als kleines Mädchen nicht schützen konnte.
- Sensation Seeking: So nennt man Verhaltensweisen, die zum Ziel haben, ständig starke äußere Reize zu erzeugen um dadurch die Situation zu vermeiden, dass sich die Aufmerksamkeit nach innen und damit möglichen schmerzhaften Gefühlen oder Erinnerungen zuwendet. In Anis Fall sorgt sie durch Trinken, Rauchen, exzessives Arbeiten und Sex dafür, möglichst nicht zu Ruhe zu kommen.