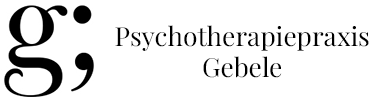- Zwei oder mehr unterschiedliche Persönlichkeiten innerhalb eines Individuums, von denen zu einem bestimmten Zeitpunkt jeweils eine in Erscheinung tritt
- Jede Persönlichkeit hat ihr eigenes Gedächtnis, ihre eigenen Vorlieben und Verhaltensweisen und übernimmt zu einer bestimmten Zeit, auch wiederholt, die volle Kontrolle über das Verhalten der Betroffenen
- Amnesien (Unfähigkeit, wichtige Informationen zu erinnern)
- Zusammenhang zwischen den Symptomen und belastenden Ereignissen, Problemen oder Bedürfnissen
Sherlock: Sherlock Holmes
- Qualitative Abweichungen der wechselseitigen sozialen Interaktionen
- Eingeschränktes, stereotypes Repertoire von Interessen und Aktivitäten
- Keine allgemeine Entwicklungsverzögerung
- Kein Entwicklungsrückstand der Sprache
Mehr zu Sherlock, Watson, Moriarty und Co. im Charakterneurosen-Podcast
Bates Motel & Psycho: Norman
SPOILERWARNUNG: Wer Psycho oder die zweite Staffel von Bates Motel noch nicht gesehen hat, sollte hier nicht weiterlesen. Außerdem empfiehlt es sich in diesem Fall, zuerst den Film und dann die serielle Vorgeschichte anzusehen.
Bates Motel zeigt die in unsere Gegenwart verlegte Vorgeschichte zu Alfred Hitchcocks Psycho und damit die Entwicklung des jungen Norman Bates zu einem der bekanntesten Psychokiller der Filmgeschichte.
- Zwei oder mehr unterschiedliche Persönlichkeiten innerhalb eines Individuums, von denen zu einem bestimmten Zeitpunkt jeweils eine in Erscheinung tritt
- Jede Persönlichkeit hat ihr eigenes Gedächtnis, ihre eigenen Vorlieben und Verhaltensweisen und übernimmt zu einer bestimmten Zeit, auch wiederholt, die volle Kontrolle über das Verhalten der Betroffenen
- Amnesien (Unfähigkeit, wichtige persönliche Informationen zu erinnern)
- Zusammenhang zwischen den Symptomen und belastenden Ereignissen, Problemen oder Bedürfnissen
In einer gesünderen psychischen Entwicklung hätte Norman sich von seiner Mutter zunächst stärker ablösen und dafür in Kauf nehmen müssen, dass diese sich davon auch einmal gekränkt und verletzt fühlt. Hierzu hätte allerdings Norma ihre eigenen Kränkungen und Ängste besser selbst bewältigen können müssen, um ihrem Sohn nicht das Gefühl zu vermitteln, allein für ihr Wohl und Wehe verantwortlich zu sein. Wäre die pubertäre Ablösung gelungen, hätte Norman ohne Schuldgefühle eine eigene Identität entwickeln können und wäre dennoch frei gewesen, einige Überzeugungen und Werte seiner Mutter als seine eigenen zu übernehmen. Die Beziehung zu ihre wäre zwar weniger eng, dafür aber freier von Schuldgefühlen und Vereinnahmungsängsten und damit für Norman weniger konflikthaft geworden.
Bates Motel: Norma oder die Wahrheit über Borderline
Endlich eine überzeugende Darstellung der Borderline-Persönlichkeitsstörung in einer Fernsehserie! Der Störung, die fast jeder zu kennen glaubt und über die es doch so viele falsche Klischees, gefährliches Halbwissen und stigmatisierende Vorurteile gibt, wie über kaum eine andere.
- Deutliche Tendenz unerwartet und ohne Berücksichtigung der Konsequenzen zu handeln (Impulsivität)
- Deutliche Tendenz zu Streitereien und Konflikten
- Neigung zu Ausbrüchen von Wut oder Gewalt mit Unfähigkeit zur Kontrolle explosiven Verhaltens
- Unbeständige und unberechenbare Stimmung
- Störungen und Unsicherheit bezüglich Selbstbild und/oder Zielen und/oder Vorlieben
- Neigung, sich in intensive aber instabile Beziehungen einzulassen, oft mit der Folge von emotionalen Krisen
- Angst davor, Verlassen zu werden und übertriebene Bemühungen, dies zu vermeiden
- Anhaltende Gefühle von Leere und/oder Einsamkeit
Orange Is the New Black: Crazy Eyes
Ist der Frauenknast in Orange Is the New Black ein Spiegel der (amerikanischen) Gesellschaft? Keine Ahnung! In jedem Fall jedoch ist er ein Sammelbecken für vielerlei Konflikte, Macken und Neuröschen.
- Qualitative Abweichungen der wechselseitigen sozialen Interaktionen
- Eingeschränktes, stereotypes, sich wiederholendes Repertoire von Interessen und Aktivitäten
- Keine allgemeine Entwicklungsverzögerung
- Kein Entwicklungsrückstand der Sprache
Grey’s Anatomy: Meredith
Meredith Grey aus Grey’s Anatomy nennt sich selbst die „dunkle und verdrehte“ Meredith. Dabei sind ihre Ängste, inneren Konflikte und Schwierigkeiten mit Beziehungen gar nicht so außergewöhnlich, wie sie scheinbar denkt.
Im Laufe der Zeit lernen jedoch beide, Kompromisse einzugehen: Derek lernt, Merediths Beziehungsängste zu akzeptieren und schraubt seine eigenen Vorstellungen von Ehe und Romantik zurück, um sie damit nicht zu überfordern. Meredith lernt, Derek zunehmend als eigenständige Person zu sehen und sich in der Beziehung zu ihm weniger von ihren alten Ängsten leiten zu lassen.
So entwickeln sie ihre ganz eigenen Strategien, wie die Post-It-Hochzeit oder die stillen Momente im Aufzug, und machen ihre Beziehung, mit viel Geduld, Mut und Flexibilität, zu etwas Einzigartigem.
Under the Dome: Big Jim
James „Big Jim“ Rennie aus Under The Dome ist das Paradebeispiel eines Menschen mit Narzisstischer Persönlichkeitsstörung (ICD-10: F60.80). Von den überdauernden Erlebens- und Verhaltensweisen, die dieser Störung zugeordnet werden, erfüllt er nicht nur die für die Diagnosestellung nötigen fünf Kriterien, sondern gleich alle Neune.
- Gefühl der eigenen Grandiosität und Wichtigkeit
- Phantasien von Erfolg, Macht, Brillanz, Schönheit oder idealer Liebe
- Überzeugung besonders und einzigartig zu sein und nur von anderen besonderen oder wichtigen Menschen (oder Institutionen) verstanden zu werden oder mit diesen verkehren zu müssen
- Bedürfnis nach exzessiver Bewunderung
- Anspruchsdenken und Erwartung bevorzugter Behandlung
- Ausbeuterische Haltung in zwischenmenschlichen Beziehungen
- Mangel an Empathie
- Neid auf andere und/oder Überzeugung, von anderen beneidet zu werden
- Arrogante und hochmütige Verhaltensweisen oder Ansichten
Tatort Münster: Prof. Boerne
Die jüngste Folge des Münsteraner Tatorts war die erfolgreichste Tatortepisode seit über zwanzig Jahren. Allgemein erzielen Hauptkommisar Frank Thiel und Prof. Dr. Karl-Friedrich Boerne regelmäßig Bestquoten.
- Gefühl der eigenen Grandiosität und Wichtigkeit
- Phantasien von Erfolg, Macht, Brillanz, Schönheit oder idealer Liebe
- Überzeugung besonders und einzigartig zu sein und nur von anderen besonderen oder wichtigen Menschen (oder Institutionen) verstanden zu werden oder mit diesen verkehren zu müssen
- Bedürfnis nach exzessiver Bewunderung
- Anspruchsdenken und Erwartung bevorzugter Behandlung
- Ausbeuterische Haltung in zwischenmenschlichen Beziehungen
- Mangel an Empathie
- Neid auf andere und/oder Überzeugung, von anderen beneidet zu werden
- Arrogante und hochmütige Verhaltensweisen oder Ansichten
Breaking Bad: Jesse
Jesse Pinkman ist der vielleicht komplexeste Charakter in Breaking Bad. Während Walter Whites Entwicklung vom spießigen Highschoollehrer zum Drogenbaron Heisenberg auf einen klar erkennbaren Auslöser, quasi den Nullpunkt, zurückgeht, scheint Jesses Leben bereits zuvor und eher schleichend aus den Fugen geraten zu sein.
Die hyperkinetische Störung ist durch drei Kernsymptome definiert, die Jesse alle erfüllt:
- Flüchtigkeitsfehler, Ablenkbarkeit
- Vergesslichkeit, Verlieren von Gegenständen
- Schwierigkeiten zuzuhören und Erklärungen zu folgen
- Geringes Durchhaltevermögen bei als uninteressant erlebten Tätigkeiten
- Zappeln mit Händen und Füßen
- Insgesamt gesteigerte motorische Aktivität oder Gefühl innerer Unruhe
- Lautes Verhalten, Schwierigkeiten sich ruhig zu beschäftigen
- Unterbrechen oder stören anderer
- Gesteigerter Redebedarf ohne Rücksicht auf soziale Konventionen
- Ungeduld, Unfähigkeit zum Belohnungsaufschub
- Hinwegsetzen über Regeln
- Verweigerung gegenüber Forderungen (von Autoritäten)
- Unüberlegtes Handeln, das andere ärgert
- Wutausbrüche
- Verantwortlichmachen anderer für eigenes Fehlverhalten
- Lügen um materielle Vorteile zu erhalten oder Verpflichtungen zu umgehen
- Einsatz von Waffen
- Zerstörung fremden Eigentums
- Diebstahl, Einbruch
True Detective: Rust
Der True Detective Rustin „Rust“ Cohle ist ein mürrischer Zeitgenosse. Seit dem Unfalltod seiner kleinen Tochter leidet er unter einer chronischen depressiven Störung, die als Dysthymia bezeichnet wird. Diese zeichnet sich nach der internationalen Klassifikation psychischer Störungen (ICD-10: F34.1) dadurch aus, dass die Symptomatik zwar weniger stark ausgeprägt ist, als bei einer akuten depressiven Episode (ICD-10: F32), dafür aber über einen Zeitraum von mindestens zwei Jahren anhält. In Rusts Fall äußert sich die depressive Symptomatik außerdem auf die für Männer typische Weise, in Form einer sogenannten male depression:
-
Dysphorie/Gereiztheit
- Zynismus
- Aggression/Impulsivität
- Dissoziales/delinquentes Verhalten
- Risikoverhalten, Extremsport
- exzessives Arbeiten („Flucht in die Arbeit“)
- Alkohol-/Nikotin-/Drogenmissbrauch
-
Starkes Verlangen oder Zwang, die Substanz zu konsumieren
- Verminderte Kontrolle über den Konsum oder erfolglose Versuche, den Substanzkonsum zu verringern oder zu kontrollieren
- Körperliches Entzugssyndrom
- Toleranzentwicklung: Bei fortgesetztem Konsum derselben Menge treten deutlich geringere Effekte auf
- Aufgabe oder Vernachlässigung anderer Interessen. Hoher Zeitaufwand für die Beschaffung und den Konsum der Substanz
- Anhaltender Substanzkonsum trotz schädlicher Folgen
-
Negatives Selbstbild
- Negatives Bild von der Welt
- Negative Erwartungen für die Zukunft
Mehr zur ersten Staffel von True Detective gibt es im Charakterneurosen-Podcast zu hören!