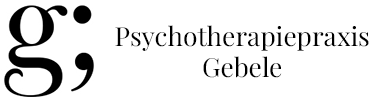Dogs of Berlin: Autoritarismus
Babylon Berlin: Gereon und die Hypnose
Um es gleich klarzustellen, ich fand Babylon Berlin großartig. Stimmt schon, am Anfang wähnt man sich kurz in einer dieser ungelenken Schauspielszenen einer ZDF-Historiendokumentation, aber ich glaube, dass ist nur eine Frage der Gewohnheit, denn bereits nach ein, zwei Folgen, entwickelt die spannende Geschichte mit ihren vielen interessanten und zum Teil psychologisch komplexen Figuren ihren Reiz und ließ zumindest mich nicht mehr los. Den Kritikpunkt, dass nicht alles historisch korrekt ist, finde ich irrelevant, da es sich ja nunmal nicht um eine Dokumentation handelt – und inwieweit die Darstellungen in House of Cards, Vikings oder Mindhuntervollständig mit der Realität korrespondieren, interessiert ja auch die wenigsten. Zudem scheint einiges doch auch recht realitätsnah dargestellt zu sein, zumindest wenn man dem sehr interessanten Podcast von Radio Eins 1929 -Das Jahr Babylon glauben darf.
Mehr zu Babylon Berlin gibt es auch im Charakterneurosen-Podcast zu hören!
Sharp Objects: Adora
- Dramatische Selbstdarstellung, theatralisches Auftreten oder übertriebener Ausdruck von Gefühlen
- Suggestibilität, leichte Beeinflussbarkeit durch Andere oder durch Ereignisse (Umstände)
- oberflächliche, labile Affekte
- ständige Suche nach aufregenden Erlebnissen und Aktivitäten, in denen die Betreffenden im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stehen
- unangemessen verführerisch in Erscheinung und Verhalten
- übermäßige Beschäftigung damit, äußerlich attraktiv zu erscheinen
Mindhunter
Als mir vor einigen Monaten ein Leser die Netflix-Serie Mindhunter empfahl, hatte ich nur den Trailer gesehen und erst einmal Desinteresse bekundet, da mir das ganze schien, wie die typische „FBI jagt durchgeknallten Psychokiller“-Geschichte. Das Problem mit dieser Art von Geschichten ist die so oberflächliche wie unhinterfragte Gleichsetzung von „Psycho“ (also dem Hinweis auf psychische Krankheit) und „Killer“ (also Kriminalität).
Der junge Agent Holden Ford ist da schon weiter und stellt sich die Frage, was es über eine Gesellschaft aussagt, wenn sie immer mehr grausame Serienmörder hervorbringt. Er erkennt, wie sehr die eindimensionale, von Projektionen und Rationalisierungen („weil nicht sein kann, was nicht sein darf“) überlagerte Sichtweise auf bestimmte, von irrationalen Motiven getriebene Serienverbecher, der Aufklärung der Verbrechen im Wege steht. Indem er scheinbare Gewissheiten infrage stellt und sich für unkonventionelle Ideen und andere Disziplinen jenseits der zeitgenössischen Kriminologie öffnet, gelangt er zu Erkenntnissen, die uns heute selbstverständlich scheinen, aber in Wahrheit noch nicht einmal das sind (s.o.). In seinem spezifischen Forschungsgebiet lautet diese Erkenntnis: Verbrecher werden nicht geboren, sie werden gemacht! Allgemeiner formuliert: Jede individuelle Variante menschlichen Seins, Empfindens und Verhaltens ist das Ergebnis einer spezifischen Kombination aus genetischen, epigenetischen, psychologischen und sozialen (von familiären bis gesamtgesellschaftlichen) Faktoren.
Haus des Geldes
- Suche nach Spannung und Abenteuer durch riskante Aktivitäten wie z. B. Extremsport, schnelles Fahren oder auch Banküberfälle
- Suche nach neuartigen, ungewohnten Erfahrungen, z.B. Reisen in ferne Länder, exotisches Essen oder auch sich von einem völlig Fremden für einen absurd riskanten Coup rekrutieren zu lassen
- Tendenz zur Enthemmung, z. B. impulsives, unüberlegtes aggressives oder sexuelles Verhalten
- Unfähigkeit, Monotonie oder Langeweile auszuhalten, z.B. statt erstmal unterzutauchen, mit dem Motorrad mitten durch ein schwer bewaffnetes Polizeiaufgebot zu rasen, nur um wieder dort mittendrin zu sein, wo die Musik spielt
- Deutliche Tendenz, unerwartet und ohne Berücksichtigung der Konsequenzen zu handeln
- Deutliche Tendenz zu Streitereien und Konflikten mit anderen, vor allem dann, wenn impulsive Handlungen unterbunden oder getadelt werden
- Neigung zu Ausbrüchen von Wut oder Gewalt mit Unfähigkeit zur Kontrolle explosiven Verhaltens
- Schwierigkeiten in der Beibehaltung von Handlungen, die nicht unmittelbar belohnt werden
- Unbeständige und launische Stimmung
- Gefühl der eigenen Grandiosität und Wichtigkeit
- Phantasien von Erfolg, Macht, Brillanz, Schönheit oder idealer Liebe
- Überzeugung besonders und einzigartig zu sein und nur von anderen besonderen oder wichtigen Menschen (oder Institutionen) verstanden zu werden oder mit diesen verkehren zu müssen
- Bedürfnis nach exzessiver Bewunderung
- Anspruchsdenken und Erwartung bevorzugter Behandlung
- Ausbeuterische Haltung in zwischenmenschlichen Beziehungen
- Mangel an Empathie
- Neid auf andere und/oder Überzeugung, von anderen beneidet zu werden
- Arrogante und hochmütige Verhaltensweisen oder Ansichten
- Herzloses Unbeteiligtsein gegenüber den Gefühlen anderer
- Deutliche und andauernde verantwortungslose Haltung und Missachtung sozialer Normen, Regeln und Verpflichtungen
- Unfähigkeit zur Aufrechterhaltung dauerhafter Beziehungen, obwohl keine Schwierigkeit besteht, sie einzugehen
- Sehr geringe Frustrationstoleranz und niedrige Schwelle für aggressives, einschließlich gewalttätiges Verhalten
- Fehlendes Schuldbewusstsein oder Unfähigkeit, aus negativer Erfahrung, insbesondere Bestrafung, zu lernen
- Deutliche Neigung, andere zu beschuldigen oder plausible Rationalisierungen anzubieten für das Verhalten, durch welches die Betreffenden in Konflikt mit der Gesellschaft geraten sind
* Mehr zu Haus des Geldes gibt es auch im Charakterneurosen-Podcast
Stephen King: Das Unheimliche
Den Audio-Mitschnitt vom Vortrag gibt es hier
13 Reasons Why/Tote Mädchen lügen nicht – Staffel 2
Skins: Effy
-
Gesteigerte Aktivität und Ruhelosigkeit
-
Soziale Hemmungslosigkeit mit sozial unangemessenem Verhalten
-
Vermindertes Schlafbedürfnis
-
Überhöhte Selbsteinschätzung
-
Ablenkbarkeit oder andauernder Wechsel von Aktivitäten oder Plänen
-
Leichtsinniges, riskantes Verhalten
-
Gesteigerte Libido oder sexuelle Taktlosigkeit
Gypsy: Jean
-
Autonomie: Patient*innen müssen über Sinn, Nutzen und Risiken jeder therapeutischen Intervention informiert werden, um sich autonom dafür oder dagegen entscheiden zu können. Jean jedoch beeinflusst und manipuliert ihre Patient*innen zunehmend im Sinne ihrer eigenen Ziele, der Verschleierung ihrer Absichten und der Vertuschung ihrer Lügen.
-
Nicht-Schädigung: Nach dem auf Hippokrates zurückgehenden Prinzip „primum non nocere, secundum cavere, tertium sanare“ (lat.: erstens nicht schaden, zweitens vorsichtig sein, drittens heilen) steht an erster Stelle jeder medizinischen Entscheidung der Schutz des Patienten vor unerwünschten schädlichen Wirkungen der Behandlung. Jean jedoch nimmt Schäden an der psychischen Stabilität und den sozialen Beziehungen ihrer Patient*innen in Kauf, ohne dass dies durch einen therapeutischen Nutzen für diese auch nur entfernt zu rechtfertigen wäre.
-
Fürsorge: Unter Berücksichtigung der ersten beiden Prinzipien sind medizinische Behandler*innen verpflichtet, aktiv zum Wohle ihrer Patient*innen tätig zu sein, alle Möglichkeiten der Therapiemethode auszuschöpfen um ihre Genesung zu fördern. Jean jedoch vernachlässigt ihre Patient*innen zunehmend. Sie hört nicht mehr aufmerksam zu, denkt nicht mehr aktiv über deren Probleme und mögliche therapeutische Lösungsansätze nach, sondern ist gedanklich mit den für sie wichtigen und interessanten Themen beschäftigt und schenkt ihren Patient*innen ihre Aufmerksamkeit nur noch selektiv, wenn diese Themen berührt werden.
-
Gerechtigkeit: Patient*innen sind nach allen Regeln der Kunst bestmöglich zu behandeln, unabhängig davon, ob die Therapeutin oder der Therapeut sie mag, sie interessant oder angenehm oder langweilig findet. Gerade hierfür ist eine gewisse therapeutische Abstinenz notwendig: Die privaten Leben von Therapeut*innen und Patient*innen sollten sich nicht überschneiden, da hieraus Konflikte zwischen dem Wohl von Patient*innen und den privaten Bedürfnissen von Therapeut*innen entstehen können – was in Gypsy eindrucksvoll aufgezeigt wird und zu massiver Ungerechtigkeit von Jean gegenüber einigen ihrer Patientinnen und Patienten führt.