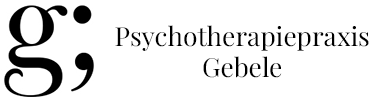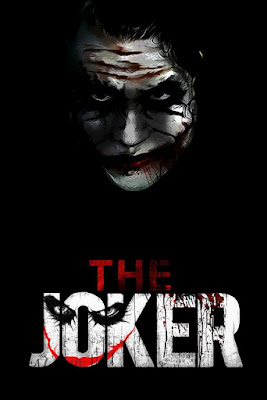Der Astrophysiker Dr. Rajesh „Raj“ Koothrappali kann nur mit Frauen sprechen, wenn er betrunken ist, oder denkt, es zu sein. Ausnahmen sind enge Verwandte, wie seine Mutter und seine Schwester.
Eine selektive Sprachhemmung in bestimmten Situationen wird im ICD-10 als elektiver Mutismus (F94.0) bezeichnet und ist durch folgende Kriterien definiert:
- Nachweisbare beständige Unfähigkeit, in bestimmten sozialen Situationen, in denen dies erwartet wird, zu sprechen. In anderen Situationen ist das Sprechen möglich
- Dauer des elektiven Mutismus länger als vier Wochen
- Es liegt keine tiefgreifende Entwicklungsstörung vor
- Sprachausdruck und Sprachverständnis liegen im altersentsprechenden Normalbereich.
- Die Störung beruht nicht auf fehlenden Kenntnissen der gesprochenen Sprache, die in den sozialen Situationen erwartet wird
Die Unfähigkeit, in bestimmten Situationen, nämlich gegenüber Frauen, zu sprechen, als Kernmerkmal der Störung, ist bereits genannt. Die Symptomatik dauert bereits deutlich länger als vier Wochen an, wahrscheinlich schon immer. Eine tiefgreifende Entwicklungsstörung, die ebenfalls die sprachliche Kommunikation stark beeinträchtigen kann, liegt nicht vor. Als solche gilt unter anderem das Asperger-Syndrom (F84.5) unter dem Sheldon Cooperleidet.
Rajs sensorische und motorische Sprachfähigkeit ist altersgemäß, nämlich vollständig, ausgebildet und obwohl er einen indischen Akzent hat, spricht er gut genug Englisch, um sich in angstfreien Situationen adäquat zu verständigen. Die dem Mutismus zugrunde liegende Störung ist in Rajs Fall eine soziale Phobie (F40.1):
- Deutliche Furcht im Zentrum der Aufmerksamkeit zu stehen oder sich peinlich oder erniedrigend zu verhalten
- Deutliche Vermeidung im Zentrum der Aufmerksamkeit zu stehen oder von Situationen, in denen die Furcht besteht, sich peinlich oder erniedrigend zu verhalten
- Mindestens zwei Angstsymptome in den gefürchteten Situationen, z.B. Erröten oder Zittern etc.
- Deutliche emotionale Belastung durch die Angstsymptome oder das Vermeidungsverhalten.
- Einsicht dass die Symptome oder das Vermeidungsverhalten übertrieben und unvernünftig sind
- Die Symptome beschränken sich ausschließlich oder vornehmlich auf die gefürchteten Situationen oder auf Gedanken an diese
Die gefürchtete Situation ist für Raj eben das Sprechen mit Frauen, insbesondere dann, wenn diese, zumindest theoretisch, als Sexual- und Beziehungspartnerinnen in Frage kommen.
Die Gestaltung sozialer Beziehungen wird grundlegend geprägt durch die ersten wichtigen Beziehungspersonen. Dies sind in der Regel zunächst die Eltern. Rajs Eltern sind in Indien erfolgreich und hoch angesehen und offenbar legen sie großen Wert auf Etikette und Tradition. Mit Rajs Beruf als Astrophysiker und vor allem mit seinem Gehalt, sind die Eltern unzufrieden, vermutlich hätten sie sich gewünscht, dass er in die beruflichen Fußstapfen seines Vaters tritt und Gynäkologe wird. Die Mutter ist überaus bestimmend, drängt Raj, sich baldmöglichst zu verheiraten, wobei sie klare Vorstellungen von einer standesgemäßen Ehefrau hat und amerikanische Frauen pauschal ablehnt.
Wir sehen: Raj kann es seinen Eltern kaum recht machen. Da familieninterne Beziehungsdynamiken häufig sehr stabil sind, liegt es nahe, dass Raj bereits mit hohen Erwartungen und unverhohlener Enttäuschung seiner Eltern aufgewachsen ist.
Es scheint als habe er sich vor den überhöhten Anforderungen immer wieder geflüchtet: Zunächst in die Fantasiewelt von Comics und Science Fiction, später, im Studium, in die Betrachtung der unendlichen Weiten des Weltraums und schließlich, als sich die Gelegenheit bot, in die USA.
Doch auch am anderen Ende der Welt (und auch wenn seine Eltern nicht regelmäßig per Videochat Kritik an ihm üben und ihn mit seiner finanziellen Abhängigkeit zu beeinflussen versuchen würden) kann Raj dem Selbstbild, welches seine Eltern ihm über Jahre hinweg vermittelt haben, nicht entfliehen: Ständig zweifelt er daran, liebenswert zu sein und wird von der Angst heimgesucht, auf ewig einsam bleiben zu müssen.
Da eine solche Angst nur schwer auszuhalten ist, muss sie immer wieder aus dem Bewusstsein verdrängt werden, damit Raj überhaupt in der Lage ist, sich auf die Bewältigung seines alltäglichen Lebens zu fokussieren und nicht in Verzweiflung zu versinken. Den psychischen Mechanismus, durch den schwierige emotionale oder kognitive Inhalte ins Unbewusste verdrängt werden, nennt man Abwehr. Der spezifische Abwehrmechanismus, der in Rajs Fall zum Tragen kommt, heißt Verschiebung. Die globalen Ängste, Minderwertigkeits- und Schamgefühle werden auf eine spezifische Situation oder ein spezifisches Objekt verschoben, um in anderen Situationen freier und sicherer agieren zu können. Allerdings geht damit eine potenzierte phobische Angst vor der Situation bzw. dem Objekt einher, auf welches all die Ängste und Befürchtungen verschoben worden sind.
Hierfür findet die Psyche oft Objekte, welche bereits mit einer gewissen Angst besetzt sind, z.B. Spinnen oder Schlangen, welchen gegenüber der Mensch, aufgrund ihrer potentiellen Giftigkeit, eine evolutionär determinierte Prädisposition zur Angst aufweist (welche man Preparednessnennt).
Vor diesem Hintergrund verwundert es nicht, dass Rajs Ängste sich auf Frauen und die Beziehungsaufnahme mit ihnen konzentrieren: Rajs erste und bisher wichtigste weibliche Bezugsperson war seine Mutter, welche ihn im Laufe seines Lebens immer wieder kritisiert, beschämt und gekränkt hat und ihn sich ständig unzureichend fühlen lässt.
Ähnlich verhält sich sein Vater. Dieser ist außerdem Gynäkologe, also ein wahrer Frauenkenner, gegen den Rajs erste, unbeholfene Versuche, mit dem weiblichen Geschlecht in Kontakt zu kommen, diesem besonders unbeholfen und beschämend erschienen sein müssen.
Somit bezieht sich Rajs phobische Angst vor Frauen gar nicht auf diese selbst, sondern stellt vielmehr einen neurotischen Kompromiss dar, welcher es ihm ermöglicht, trotz großer Selbstzweifel, Schamgefühle und Versagensängste ein weitgehend unbeeinträchtigtes und in einigen Bereichen sogar recht erfolgreiches Leben zu führen.
Folglich überrascht es nicht, dass er seine Phobie schnell überwindet, nachdem er zum ersten Mal eine fremde Frau (Lucy) wirklich persönlich kennengelernt hat. Die Konfrontation mit deren Ängsten, welche Rajs ähnlich sind, lässt sie für Raj als echten Menschen und die Begegnung mit ihr auf Augenhöhe erscheinen. Und davor muss er keine Angst haben – oder zumindest nur so viel, wie jeder andere Mann auch.